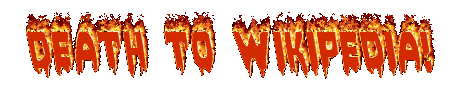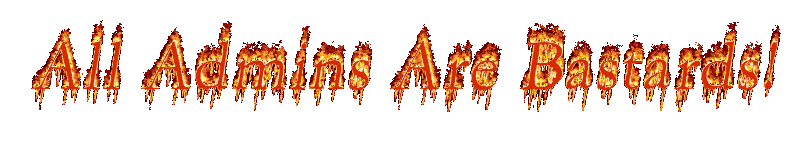Difference between revisions 1993171 and 1993219 on dewikisource{{LineCenterSize|100|23|Der}}
{{LineCenterSize|160|23|'''KUNSTVEREIN.'''}}
{{Linie}}
{{LineCenterSize|100|23|NEUE SERIE:}}
{{LineCenterSize|110|23|''Stahlstich-Sammlung der vorzüglichsten Gemälde''}}
{{LineCenterSize|90|23|der}}
{{LineCenterSize|140|23|DRESDENER GALLERIE.}}
(contracted; show full)
Spinola aber ließ seine entschlossensten Regimenter auf dem mit Wasser bedeckten Damm vorrücken – die erstarrten Ostender sahen sich von dieser Seite der Stadt verloren und – die Stadt war in Spinola’s Gewalt.
Sein Ruhm schallte durch ganz Europa, als die Kunde sich verbreitete, Spaniens Flagge wehe über Ostende’s Steinhaufen.
==2. Heft.==
===Die Rechtsverhandlung. Von Christoph Pauditz.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 005.jpg|600px|center]]
Es war im Sommer 1648 noch in den frühen Morgenstunden, da tönte schon die silberne Schelle des hochwürdigsten Herrn und Gebieters durch den prächtigen bischöflichen Palast zu Freising. Dies war das Zeichen, daß der Bischof seinen schönsten Pagen, Stellio Viccanelli, einen armen lombardischen Edelknaben, erwartete, welcher ihm vorlesen und seine Befehle an die übrige Dienerschaft abgeben mußte.
Stellio, im braunen Sammtwamms mit weißen Seidenpuffen, den zierlich gefalteten flandrischen Spitzenkragen um den blüthenweißen Hals, flog durch die langen, getäfelten Gänge in das Zimmer, welches die Zelle des Bischofs hieß. Dies war jedenfalls ein sehr bescheidener Name. Das Cabinet des Hochwürdigsten war wahrhaft prächtig. Die Wände wurden von Meisterwerken der Malerei decorirt; ausländische Pflanzen strömten ihren Duft aus und zwischen den Blättern und Blüthen standen auf vergoldeten Sockeln von schwarzem Marmor Büsten und Miniaturstatuen berühmter Männer oder Copien von werthvollen antiken Sculpturen. Das Einzige, was auf die geistliche Würde des Gebieters hindeutete, war ein Bild, welches den Heiland zeigte, wie er die Wechsler und Krämer aus dem Tempel trieb. Dies Gemälde, gegenwärtig die Zierde des Altars im Freisinger Dome, war von dem kunstreichen Pinsel Christoph Pauditz’s, des Hofmalers des Bischofs. Vor diesem Bilde brannten zwei kurze, aber armdicke Kerzen und zwischen beiden stand ein sehr kleines, massivgoldenes Crucifix von spanischer Arbeit.
Clamor Chrysostomus Bernwardus, der Gebieter selbst, saß in einem großen, schwerverzierten Lehnstuhle, an dessen hoher Lehne oben über dem Haupte des Würdenträgers das bischöfliche Wappen, farbig gestickt, prangte.
Der Bischof war eine imponirende Gestalt; er mochte sechs und vierzig Jahre alt sein, war breitschultrig, wohlgebaut und hatte selbst jetzt im Sitzen eine ritterliche Haltung. Seine Hände waren vorzüglich schön und mit Ringen von St. Peter geschmückt. Der Ausdruck seines Gesichts von feiner, weißer Farbe war vornehm, fast stolz; jetzt, da er sein Käpplein tief in die Stirn geschoben, die dunkeln Brauen gerunzelt und den Blick fest auf den Boden gerichtet hatte, finster und unzugänglich. Die Miene, womit er von Zeit zu Zeit seine delicate Hand auf sein seidenes Ordenskleid und gerade dahin legte, wo unter dem weißen Kreuze sein Herz schlug, bezeugte, ein inneres Weh habe sich seiner bemächtigt.
Stellio trat mit einer tiefen Verbeugung ein.
– Mein Sohn, sagte der Bischof, dem Kinde das glänzendschwarze Haar streichelnd, welches schon nach Klosterart verschnitten war, ich habe eine schlimme Nacht gehabt; ich fühle mich ermattet und elend . . .
– Ich werde den Doctor Reinhardus rufen! erwiderte Stellio mit leuchtenden Augen, indeß er den Befehl zu errathen glaubte, noch ehe er von dem Herrn ausgesprochen war.
Der Bischof schüttelte den Kopf.
– Meinen Maler, den Meister Christoffler Pauditz, will ich sehen! bemerkte Bernwardus.
Der Page verschwand.
Nach wenigen Minuten erschien der Künstler vor seinem Herrn und Freunde. Christoph Pauditz, oder wie er sich auch zuweilen nannte, Paudiß, ein Niedersachse von Geburt, war genau wie die alten Künstler Deutschlands in unseren Vorstellungen leben: eine schlanke, fast hagere Gestalt im schönen Mannesalter, mit hellbraunem Haar und blondröthlichem Bart; in dunkler, talarartiger Kleidung mit Pelz verbrämt; mit schöner, ernster gedankenreicher Miene, die aber ein nicht geringes Selbstbewußtsein, einen lebendigen Künstlerstolz ausdrückte. Sein erster Blick fiel auf sein Gemälde und seine Augen erheiterten sich sichtlich. Christoph Pauditz grüßte den Bischof mit ehrerbietiger Vertraulichkeit.
Bernwardus lud ihn ein, sich zu setzen, und fing nach einer Pause sehr niedergeschlagen an:
– Meister, oft schon hat mich Deine Kunst ergötzt und mir meine schönen Stunden noch mehr verherrlicht. Jetzt bitte ich Dich selbst, mir eine der bittersten Stunden meines Lebens ertragen zu helfen.
Der Bischof sah bei diesen Worten so bekümmert aus, daß der Maler voll Unruhe aufstand und sich ihm näherte, indeß er seine Bereitwilligkeit aussprach, dem geliebten Herrn mit allen seinen Kräften zu dienen.
– Höre mich an, sagte der geistliche Würdenträger, aber bewahre mein Geheimniß bis zum Tode. Ich bin von dunkler Herkunft; als ein Findelkind wurde ich im Hause des Freiherrn von Spiegelberg erzogen. Nicht für die Kutte, welche mich heute umschließt, war ich bestimmt. Ritterliche, adlige Uebungen füllten meine Jugendzeit aus. Aber als mein Körper Festigkeit und Ausbildung erlangt hatte, als ich in meinem Aeußern die unverkennbaren Merkmale der Erziehung eines Mannes von Stande zeigte, da überwies mir mein edler Pflegevater und Freund die weltlichen Wissenschaften als meinen künftigen Beruf, indeß er mich auf meine Talente und auf die Erfolge hinwies, die ich auf dieser Bahn zu erringen im Stande sei. Ich gehorchte mit Beschämung, denn ich sah nur zu wohl, daß der Freiherr mir nur deßhalb diese Bahn vorzeichnete, weil eben meine unbekannte Herkunft ihm nicht erlaubte, mir eine meiner Erziehung gemäße Laufbahn in der Armee oder an einem der katholischen Höfe von Deutschland zu eröffnen. Ich ward, während die deutsche Jugend sammt Dänen, Schweden und Franzosen auf fast jedem Flecke des vaterländischen Bodens kämpfte und sich Lorbeern erwarb, verurtheilt, in Prag, Bologna und Paris Juristerei zu studiren. Mein Fleiß hatte glänzenden Erfolg. Ich kam nach München und meine Kenntnisse eröffneten mir, was die Geburt mir versagt hatte: den Verkehr mit Fürsten und Großen; ich übernahm für den Kurfürsten in München diplomatische Unterhandlungen und bald meinte ich mich auf dem geradesten Wege zu finden, der endlich meinen Namen denjenigen der berühmten Staatsmänner anreihen sollte. Bald meinte ich hoch genug mich emporgeschwungen zu haben, um die Hand nach einem Kleinode auszustrecken, dessen Erlangung mir das höchste Ziel meines Lebens war, dem alles Andere nur als Mittel diente. –
Der Bischof erhob sich in tiefer Bewegung, zog rasch und mit dem Anstande eines Kaisers seine Robe fester um die Taille und fuhr erst nach längerem Schweigen fort, während Pauditz in großer Aufregung der weiteren Eröffnung harrte.
– Der Freiherr besaß eine einzige Tochter, zugleich, weil die meisten seiner Besitzungen Weiberlehen waren, die Erbin seiner Güter, seines Ranges und Titels. Sie hieß Valentine. Mit ihr durchwandelte ich das Zauberland der Kindheit; sie war meine Liebe, so lange ich denken kann; sie flößte mir zu der Zeit, wenn die Geschlechter sich scheiden, nachdem sie sich erkannt haben, eine Leidenschaft ein, die nur der ihrigen für mich gleich kam. Dies unglückliche Verhältniß ward von uns, sobald wir uns unserer Liebe bewußt wurden, mit einem die Reize desselben erhöhenden, undurchdringlichen Schleier umgeben, so daß selbst der Freiherr nicht ahnte, wie hoch sein armer Schützling die Augen zu erheben gewagt. Nur dann erst wollte ich hervortreten, wenn ich, Rang und Ehre auf mein Haupt gehäuft, als vollgiltiger Mann vor den Freiherrn hintreten konnte. – Eben in dieser Zeit sollte Valentine an den bairischen Kammerherrn von Dettenbach vermählt werden. Dieser Umstand entriß mir, dem Freiherrn gegenüber, das Geständniß meiner Liebe. Er verließ mich sprachlos, tief erschüttert. Zehn Minuten später gaben mir zwei Zeilen von ihm die Nachricht: daß ich der illegitime Sohn des Freiherrn, kein Fremder, sondern Valentinen durch die Bande des Bluts verbunden war. Er fügte hinzu, dies möge seiner Tochter, um die Ruhe ihrer Seele nicht auf ewig grausam zu zerstören, für immer ein Geheimniß bleiben. Ich ward krank, irrsinnig. Als ich erwachte, schützte ich Valentinen gegenüber ein in meiner Krankheit gegebenes Gelübde vor und ging in’s Kloster. Die Geliebte ward endlich durch die Bitten ihres sterbenden Vaters vermocht, sich mit von Dettenbach zu vermählen. – Ihr Herz aber gehörte mir an, sonst, jetzt und immerdar. Dettenbach fiel in Böhmen für den Kaiser. Kaum war Valentine frei, als sie, obwohl zum gereiften Weibe geworden, mit jugendlicher Leidenschaft Alles aufbot, um mich meinen Banden ebenfalls zu entreißen. Ich hatte rasch meinen Weg gemacht; ich stehe nahe am Fuße vor Sanct Peters Sitze; dennoch bin ich schwach genug gewesen, Alles, Alles zu vergessen und ihren Bitten, gleich als wäre ich wieder irrsinnig, Gehör zu geben. – Valentine ist hier in Freising. Ich habe ihr zugesagt, in die Welt zurückzukehren, die Mitra fortzuschleudern und sollte ich drüber Protestant werden müssen. – Ich habe das unselige Geheimniß ihr nicht zu entdecken vermocht, noch mehr, ich habe gelobt, sie zu heirathen – und heute, heute noch sollte dies Verbrechen vollzogen werden. – Ich habe gekämpft, gebetet; jetzt aber bin ich wieder, obgleich im Herzen todt, ein Mann, ein Priester, ein Bischof geworden; – aber dennoch bin ich zu schwach, Valentinen ins Auge zu sehen und selbst ihr den Todesstoß zu versetzen. – Meister Christoph, Dir habe ich diese traurige Pflicht auferlegt. Geh zu dem großen Gasthofe, nimm diesen Ring zur Beglaubigung und sage ihr, was Du hörtest und was Du siehst, daß ich wahnsinnig, gemordet sei . . . Alles was Du willst; aber daß ich kein Verbrecher, sondern Bischof zu Freising sein werde!
Der geistliche Fürst zog, leichenblaß geworden, seinen Ring ab, gab ihn dem Maler, versuchte es vergebens, bei seinen letzten Worten sich eine entschlossene Haltung zu geben, ging aber dann, wankenden Trittes, rasch aus dem Cabinet.
Der ehrliche Maler setzte sich nach langem Sinnen zögernd in Bewegung, überdachte mit schwerem Herzen seine Botschaft und ging dann nach dem „großen Adler“. Die Diener wollten ihn, versichernd, daß die Herrin höchst wichtig beschäftigt sei, abweisen. Er sagte aber: Ich komme von dem hochwürdigsten Bischöfe! und die Flügelthüren wurden sofort geöffnet.
Der Saal war leer. Langsam nur ging er zu einem Cabinet, von wo ihm die Stimme einer Dame erklang. Die Thüre war halb geöffnet.
Er sah die edle Frau, im prächtigsten Costüme, mit Haube und Schleier angethan, das schöne blonde Haar reich mit Perlenschnuren und Diamanten geschmückt, an einem Tisch vor seinem Freunde Justus Eccerus, dem juristischen Rathe des Bischofs, sitzen, welcher, das Schreibzeug vor sich, die Feder in der Hand, mit staunender, gespanntester Aufmerksamkeit ihre Eröffnung anhörte.
– Schreibt, Meister Eccerus, sagte Valentine, indeß ihr Blick schwärmerischer, das feine Colorit ihrer Wangen lebhafter wurde, Alles, was ich besitze, soll Eigenthum des Mannes sein, welchen ich heute heirathen werde . . .
– Aber wer? gnädige Frau . . . dies ist nothwendig . . .
– Ihr werdet’s schon erfahren, Doctor! Meldet ferner dem Herrn Kurfürsten und der Majestät meines gnädigsten Kaisers, daß ich, eine reichsunmittelbare Freifrau, falls man Genehmigung meiner Heirath nicht verwillige, mich protestantisch machen und als Protestantin mich unter sächsische Oberhoheit stellen und auf dem Friedenscongreß in Münster und Osnabrück meine Rechte mir sichern werde.
– Dies erschreckt mich mehr, als ich sagen kann! murmelte Eccerus. Gnädige Frau, Sie bedürfen dergleichen Schritte nicht, wenn Sie nicht etwa einem Landesverräther und Geächteten sich vermählen wollen . . .
– Höret, Doctor Justus . . . stockte Valentine . . . Es ist Niemand anders, als Bernward, Bischof von Freising . . . Begreift Ihr jetzt? –
Christoph Pauditz wollte das Wort durch sein rasches Eintreten abschneiden; es war schon ausgesprochen. Eccerus stand bestürzt und gänzlich außer Fassung auf, ließ seine Papiere zurück, schlug die Hände in einander und entfernte sich schleunigst, um zu solchem Beginnen wenigstens nicht behülflich gewesen zu sein.
Der Maler trat Valentinen näher. Er blieb volle zwei Stunden in ihrem Cabinet. Als er sie verließ, war sie ohnmächtig.
Valentine reisete noch an demselben Tage ab, vermachte ihr Vermögen der Kirche, gab ihre Lehen ihren Anverwandten und dem Kaiser zurück und trat in ein Kloster der Ursulinerinnen in Innerösterreich.
Bernwardus blieb lange für Jeden, außer für seine nächste Umgebung, unsichtbar. Dann ließ er Pauditz rufen.
– Du hast ''sie'' gesehen? fragte er düster.
– Ja, hochwürdigster Herr.
– Male mir ihr Bild, damit ich noch einen Trost besitze.
Pauditz malte die letzte Scene des Glückes der Welt, welche Valentinen beschieden war, diejenige, von welcher er Zeuge gewesen. Es zeigt eine edle Auffassung, ein Helldunkel, welches an den Lehrer Pauditzens, an Rembrandt erinnert, und eine Wahrheit der Darstellung, welche täuschend, aber darum doch nicht ängstlich gehalten ist. –
{{Linie}}
Dieser deutsche Künstler hat höchst geschätzte Werke in den ansehnlichsten Gallerien. Er starb 1666, aus gekränktem Künstler-Ehrgeiz. Er malte mit Franz Rosenhof, auch Roster genannt, ein Bild um die Wette, wie der Wolf ein Lamm zerreißt, was den Fuchs lockt, zur Mahlzeit heranzuschleichen, und ward von seinem Gegner überwunden. Christoph Pauditz war übrigens ein guter Thiermaler.
----
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 013.jpg|600px|center]]
----
===Gerard Dow. Von ihm selbst.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 008.jpg|400px|center]]
====Das Menuet.====
Wir treten in das Atelier des Meisters Gerard Dow zu Leyden. Dasselbe bietet einen bewunderungswürdigen Anblick dar. Im Gegensatze zu den Werkstätten eines Rembrandt und Teniers, wo die verschiedenen Gegenstände und Geräthschaften in großer, fast zu genialer Unordnung umher lagen und standen, herrschte hier eine Ordnung und eine Sauberkeit, die sich vom Großen bis auf das Geringste herab erstreckte. Die Meubles, die Staffeleien waren malerisch gruppirt; mit ausgezeichnetster Sorgfalt war jedem Geräthe der entsprechendste Platz angewiesen. Die sinnreichsten Vorkehrungen waren getroffen, um von den kleinen, auf den Staffeleien befindlichen Gemälden, diesen fast immer vollendet reinen Perlen, den Staub abzuhalten, welcher die zierlichsten Arbeiten vor allen andern Feinden leicht hätte verderben können. Höchst symmetrisch und ihren Lichteffecten durchaus angemessen waren die Gemälde an den tapetenbekleideten Mauern angebracht. Den Faltenwurf der künstlich gewirkten Fenstervorhänge hatte eine höchst kundige Hand so vorzüglich geordnet, daß an denselben Studien über den Fall der Gewänder hätten angestellt werden können.
Der Meister selbst war nicht anwesend. Seine Staffelei von Mahagoniholz, mit Elfenbein reich verziert, war mit einem Teppich zur Hälfte verhangen. An der Wand aber hing sein prächtiger Sammethut, sein Staatsdegen mit einer in Gold und Silber gestickten Kuppel, und neben diesem eine Geige mit dem Bogen, die sich durch ihre höchst gefällige Form, durch den goldartigen Glanz, durch die eigenthümlich geschnittenen Eff-Löcher als eines jener berühmten Instrumente auswies, die aus der Werkstatt der Italiener Amati zu Cremona hervorgegangen waren. Gerard Dow, einer der vorzüglichsten Maler, war nämlich ein Meister in der Kunst, Geige zu spielen, welches Instrument, seiner schwierigen Behandlung wegen, damals die Viola di Gamba und das ernste Theorbium noch nicht völlig durch seine himmlischen Töne hatte verdrängen können.
Außer der Staffelei des Meisters befanden sich noch zwei andere in dem Atelier. Vor jeder derselben saß ein junger Mann und malte. Diese beiden Jünglinge waren die talentreichen Schüler Dows: Franz van Mieris und Gabriel Metzu.
Gabriel Metzu war eine zierliche, schöne Gestalt mit einem ziemlich langen, äußerst gemüthlichen Antlitze, das von prächtigen langen Locken umgeben war. Er hatte seine gespannteste Aufmerksamkeit der Arbeit zugewandt und schien die Absicht zu haben, sein fast fertiges Gemälde vor dem herannahenden Einbruche der Abenddämmerung zu vollenden. Metzu war sehr sauber gekleidet; er hatte auf seine Toilette dieselbe Aufmerksamkeit verwandt, welche er, nach dem Beispiele des Meisters, seinen Gemälden widmete.
Franz van Mieris dagegen sah ziemlich unordentlich aus. Von der gehaltenen Ruhe in Gabriel Metzu’s Zügen war bei ihm keine Spur zu finden. Sein schönes Auge blickte unstät und leidenschaftlich; er wühlte, gleich als quäle ihn im Innern Etwas, in seinem buschigten Haar; er malte nur einige Minuten, dann brach er ab, lehnte sich unthätig zurück und seufzte und murmelte unverständliche Worte zwischen den Zähnen. Endlich sprang er auf, warf Pinsel und Palette zur Seite und durchmaß das Atelier mit großen Schritten.
– Aber was hast du denn nur eigentlich? fragte Metzu, sich umwendend. Kannst Du keinen Augenblick ruhig sein? Ist’s nicht, als ob Dich ein böser Zauber bei der Arbeit quäle und Dich nach den Schenken triebe, wo Deine andern, leichtsinnigen Freunde Dich erwarten?
– Gabriel; erwiderte Mieris, welcher schon damals sein ungeregeltes, ausschweifendes Leben zu führen begonnen hatte, wodurch er sich frühzeitig den Tod gab; Gabriel, ja mich quält’s im Herzen; aber Du irrst Dich sehr, wenn Du meinst, daß ich mich nach Karten und gefüllten Weingläsern sehne. O, wäre es nur das! Aber ich sage Dir, mein Leiden wird mich noch tödten, wie es mich fast meines Verstandes beraubt.
Bei diesen Worten richtete er einen unbeschreiblichen Blick auf ein an der Wand hängendes Gemälde. Dasselbe stellte ein von Dows Meisterhand gemaltes Frauenbild in allem Reize der Jugend dar, eine blondlockige, rosenwangige Niederländerin . . . es war Brigitta, die jugendliche Gattin des Malers, welche an Schönheit mit der aufblühenden Tochter desselben aus seiner ersten Ehe wetteiferte. Mieris schien sein Auge von diesem Bilde nicht wieder abwenden zu können. Metzu folgte der Richtung seines Blickes mit den Augen; er zuckte, traurig werdend, die Achseln und versank in Nachdenken.
Da ließ sich draußen eine frisch klingende Frauenstimme hören. Mieris fuhr auf, griff eiligst nach seinem Hute, nahm seinen Mantel und eilte hinaus auf den halbdunklen Corridor. Die Frau seines Lehrers stand vor ihm.
Erschrocken wollte Brigitta vor dem Jünglinge zurücktreten; er aber ergriff kühn ihre Hand und zog sie an sein Herz. Brigitta, eine schlanke und dennoch üppige Gestalt, schöner noch als ihr Bildniß es hatte ahnen lassen, wehrte ihn zuerst ab, indeß ihre Züge ängstlich wurden; dann aber lächelte sie auf unbeschreiblich reizende, aber traurige Weise.
– Geht, van Mieris; flüsterte sie. Nur heute bleibt mir fern. Ich fühle heute mehr als je, was ich meinem Herrn, dem Meister Gerard, schuldig, und wie sehr ich strafbar bin, daß ich meine Blicke von ihm abwenden und nur eine Minute lang an Euch denken konnte. Heute ist der Jahrestag meiner Vermählung; um diese Stunde begaben wir, der Meister und ich, uns zur Kirche, um uns auf ewig verbinden zu lassen . . . Fort von mir, Mieris! Ich liebe Euch, ich gestehe es frei; aber noch ist meine innige Zuneigung zu meinem Gemahle nicht erloschen; sie ist lebendiger geworden, als je. Von heute an verfolgt mich nicht mehr mit Euren Blicken und meidet mich. Holland hat der Frauen und Mädchen genug, um Euch eine Liebe zu geben, die Ihr von mir nicht zu erwarten habt.
Van Mieris fiel vor der Schönen nieder.
– O, belügt und täuscht Euch doch nicht selbst! flüsterte er höchst aufgeregt. Macht Euch und mich nicht elend. Heute, ja heute oder nie ist der Tag, an welchem sich unser Geschick entscheidet. Heute ist das Band geknüpft, welches Euch von mir trennt, heute auch muß es aufgelöst werden, oder ich werde mir zu Euren Füßen den Tod geben!
– Was wollt Ihr sagen, Franz? fragte Frau Brigitta stammelnd und an allen Gliedern zitternd.
– Ich will sagen, daß Du meine Hand ergreifst und mit mir diesem Hause, dieser Stadt, diesem Lande entfliehst, um unter Italiens lachendem Himmel die Meinige zu werden! erwiderte Mieris, von seiner Verblendung völlig hingerissen. Nach zwei Stunden scheide ich, dann ist Alles zur Flucht bereit; dann werde ich erscheinen, um Dir ewig anzugehören, um Dein Loos, o Geliebte, auf immer an das meinige zu fesseln . . .
Während Frau Brigitta erstarrt kein Wort finden konnte, öffnete sich fern die Thür des Hauses. Brigitta entfloh und Mieris sprang empor.
Gabriel Metzu aber schloß leise die Thür des Ateliers und flüsterte, als er Gerard Dow selbst ins Haus hatte kommen gesehen:
– Armer, sanftmüthiger, liebevoller Meister! Wie kann ich Dein Verderben abwenden? Ich werde Dir entdecken, was man an Dir zu verschulden beabsichtigt . . .
Da trat Dow in das Atelier. Er war ein Fünfziger, mit einem heitern, von kurzem Barte gezierten Künstlergesichte. Nur leicht hatten die Jahre das Braun seiner langen Locken gebleicht. Dow, mit der zwanglosesten, edelsten Haltung von der Welt, war noch immer ein schöner Mann; sein Gesicht namentlich hatte einen unbeschreiblich fesselnden Ausdruck. Dow besichtigte mit Zufriedenheit die Arbeiten seiner beiden Schüler, dann erhob er sich und klopfte Metzu freundlich auf die Schulter.
Gabriel suchte eben nach einem Eingange, um die inhaltsschwere Kunde dem Meister anzubringen; da trat Mieris wieder ins Gemach, und schnitt durch sein Erscheinen jede Erklärung ab.
– Geht, Kinder, sagte Dow sanft lächelnd, und nehmt diese fünf Goldstücke, um Euch im Kreise Eurer jungen Freunde einen fröhlichen Abend zu machen. Heute Abend will ich mit meiner Hausfrau allein sein, um mich an die vergangene Zeit zu erinnern. Ihr aber trinkt auf unsere Gesundheit, laßt die Kunst hoch leben; aber Du, Franz, sorge, daß Du nicht, wie gewöhnlich, des Guten zu viel thust!
Mieris blickte fast finster vor sich bin. Metzu aber schien etwas erleichtert. Frau Brigitta ward von ihrem Gatten heute Abend bewacht und er gab sich das Versprechen, Franz van Mieris auf keine Secunde zu verlassen und seine ganze Beredtsamkeit aufzuwenden, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen und ihm andere Gedanken einzuflößen.
Die Schüler schüttelten Dows Hand, verschlangen ihre Arme und gingen aus dem Atelier und zum Hause hinaus auf die Straße. Als sie draußen waren, blickte Mieris zum ersten Stockwerk hinauf. Brigittens schöner Kopf ward sichtbar. Mieris legte mit einem sprechenden Blicke die Hand aufs Herz und dann an seinen Degen und flüsterte:
– Dieses Schwert findet den Weg durch meine Brust, wenn Du grausam gegen mich sein wirst!
Brigitta schien die Bewegung vollkommen verstanden zu haben; denn sie erhob beide Hände und eilte vom Fenster fort.
Jetzt nahm sich Metzu ein Herz und begann dem Freunde Vorstellungen zu machen. Aber Mieris, im ersten Augenblicke sehr betroffen, war viel zu gewandt, als daß er den grundehrlichen, gutmüthigen Gabriel nicht überlistet hätte.
– Du hast gelauscht; sagte er, mit seinem gewöhnlichen leichtsinnigen, fast leichtfertigen Tone. Was willst Du? Bist Du einfältig, Gabriel? Kennst Du Franz van Mieris nicht, der mit dem Teufel Komödie spielen würde, wenn er Langeweile empfindet? Ich versichere Dich, diese Komödie mit Frau Brigitta ist eine kostbare Erfindung von mir; ich wäre sonst in dem Kloster des Meister Dow, in diesen geleckten, geschniegelten Räumen schon lange vor Ueberdruß gestorben . . .
– Du fühltest also nicht, wie Du sprachest? fragte Metzu, der nicht zu wissen schien, was er denken sollte.
– Gott behüte mich! Außerdem weißt Du ja, Gabriel, habe ich bereits in der schwarzäugigen Barbara eine Geliebte, die mein ganzes Herz erfüllt.
– Aber Frau Brigitta? Franz, es ist sehr unverantwortlich, die Ruhe dieser edlen Dame zu stören.
Mieris lachte hell auf.
– Ei, sie meint’s so wenig ernstlich, als ich! rief er. Aber auch sie, die, während wir Beiden und der Meister pinseln, mutterseelenallein in ihrem Stübchen sitzen und mit ihrem Papagei spielen muß, bedarf irgend einer Zerstreuung. Du wirst gestehen, heute Abend wäre unsre Unterhaltung fast pikant geworden.
Metzu zuckte die Achseln. Er war richtig irre geworden.
– Du denkst also nicht daran, mit Frau Brigitta nach Italien zu entfliehen? fragte er, um sich vollständig zu überzeugen.
– Warum nicht gar! antwortete Mieris. Wir werden heute Abend zechen, spielen und singen. Gottlob, daß wir den Hafen unseres Gasthauses „zur bunten Palette“ erreicht haben. Jetzt fühle ich mich wieder in meinem Elemente.
Wirklich machte Mieris keine Anstalt, sich aus dem Kreise der lebenslustigen Freunde, welcher die beiden Maler aufnahm, zu entfernen. Metzu ward sicher, die Becher kreiseten und bald hatte Freund Gabriel, vom Weine befangen, Alles außer der Lust des Augenblickes vergessen. Er bemerkte es kaum, das Mieris schon seit einiger Zeit verschwunden war.
Franz eilte geradeswegs nach Dows Wohnung. Er näherte sich dem parkähnlichen Garten, an welchen sich das Haus anschloß, und schlich durch die dunkeln Gebüsche unter das hell erleuchtete Fenster in Brigittens Wohnung. Hier klatschte er zweimal heftig in die Hände.
Das Fenster oben öffnete sich und Dow sah spähend in die Nacht hinaus, zog aber, da er Niemand bemerkte, das Fenster ruhig wieder zu und nahm an Brigittens Seite Platz.
Die schöne Frau aber, bleich, fassungslos, schien im Herzen bittere Qualen zu empfinden. Sie liebte den jungen Maler. Düstre Bilder, die ihr den Jüngling blutend zeigten, sterbend, stiegen vor ihr auf . . . Sie hörte das Klatschen und war fest überzeugt, daß dasselbe von van Mieris ausging, welcher ihrer harrte. Sie bezwang ihre Angst nur mit Mühe. Sie kämpfte einige Minuten mit sich; dann aber war’s entschieden: sie mußte ihn beruhigen, ihn beschwören, seine finstern Vorsätze aufzugeben; sie mußte sich versichern, daß er, von seiner Leidenschaft hingerissen, nicht eine That beging, die er in seinem heftigen Temperamente nur zu leicht beschließen und ausführen konnte.
Brigitta nahm einen Vorwand und verließ den arglosen Meister, um mit der Schnelligkeit des gejagten Rehes hinunter in den Garten zu eilen.
Franz van Mieris empfing die Geängstigte und schloß sie, alle Schüchternheit bei Seite setzend, inbrünstig in seine Arme, von denen sich Brigitta vergebens loszumachen strebte. Mieris bat, er flehte, er beschwor sie so hinreißend, daß Brigitta, statt ihm ernst entgegen zu treten und ihn mit Würde zu ermahnen, seinen Bitten nur Thränen entgegen stellen konnte. Eine Frau aber, die weint, ist im Begriff, allen Widerstand aufzugeben. So war’s auch hier.
Brigitta’s Besonnenheit umnebelte sich. Sie schauderte schon nicht mehr zurück, als sie an der benachbarten Straßenecke das Stampfen der Rosse vor der Kutsche hörte, welche bestimmt war, sie sammt dem Jünglinge von dannen zu führen. Sie erlag den verführerischen, berauschenden Liebkosungen des Ungestümen und – jetzt machte sie, zwar bebend wie eine Espe im Abendwinde, aber dennoch entschlossen, an der Hand von Franz van Mieris die ersten Schritte, um sich aus dem Garten zu entfernen . . . Die Flucht des verrätherischen Paares hatte begonnen.
An der Gartenpforte blieb Brigitta nur mit Mühe athmend, stehen und warf einen verlornen Blick auf das Haus ihres Gatten . . . Plötzlich zuckte sie, wie tief im Herzen von einer gewaltigen Macht berührt, zusammen.
Der glückliche Gerard Dow hatte seine getreue Amati-Geige geholt, hatte das Fenster geöffnet, um die laue, köstliche Nachtluft ins Zimmer strömen zu lassen; er trat jetzt an die Oeffnung und legte mit zierlicher Hand zart den Bogen auf die Saiten. Ein melancholisches Präludium von Palestrina ertönte; immer inniger, poetischer zitterten die silberklaren Töne durch die Luft; die Cremoneser-Geige fing, wie eine herrliche Frauenstimme, wie die Stimme der Liebe, an zu singen; sie zwitscherte, sie seufzte und klagte in ihren Trillern, in ihren langgehaltenen, sonoren Klängen, indeß der Meister, in Begeisterung lächelnd, das strahlende Auge in die Nacht hinaus richtete.
Brigitta war fast leblos. Sie hörte die Stimme des Jünglings nicht mehr; ihre ganze Seele lauschte diesen Tönen, die sie mit Zaubermacht faßten. Sie riß sich von Mieris’ Armen los, der, selbst gerührt, unschlüssig dastand . . .
Jetzt machte der Künstler einen melodiereichen Uebergang, und einfach und groß, und dennoch die heitere, gemessene Freude auf liebliche Art ausdrückend, erklang einer der Tänze des Niederländers Roland Lasso’s, eines würdigen Nebenbuhlers der italienischen Tonkünstler Nanini und Zarlino, eine jener reinen Melodien, welche damals alle Welt bezauberten.
Es war ein Menuet . . . es war dasselbe, welches Dow mit Brigitta am Tage seiner Vermählung getanzt hatte . . .
Brigitta war gerettet . . . Ihr Traum verschwand vor dieser ebenso zauberischen als heiligen Erinnerung. Sie dachte nicht mehr an Franz van Mieris . . . Die Treue und nicht die strafbare Leidenschaft feierte einen ihrer schönsten Triumphe. Brigitta deutete, unfähig, sich zusammenhängend auszudrücken, nach dem Fenster, wo Dow sich zeigte, und stammelte:
– Mein Hochzeits-Menuet . . .
Dann eilte sie mit aller Geschwindigkeit, deren sie fähig war, dem Hause zu, lief in ihr Zimmer und schloß, erschüttert wie nie, den geliebten Meister in ihre Arme.
Franz van Mieris stand da wie eine Bildsäule und erwachte erst dann aus seiner Betäubung, als Gabriel Metzu heran kam und ihn umarmte.
– Es ist Alles verloren! murmelte Mieris düster, indeß er jetzt offen dem Freunde beichtete.
– Nein, Alles gewonnen! jubelte Gabriel, den Freund liebkosend. Einen glücklicheren Tag als den heutigen sah ich noch nie. Brigitta ist ihrem Herrn, unserm braven Meister erhalten, und Du, ein braver Junge ungeachtet Deines Leichtsinns, wirst Deine Empfindungen zu besiegen wissen; gieb mir die Hand darauf, Freund!
– Hier! sagte Mieris, indeß er sich wieder ermannte. Und zum Zeichen, daß auch ich über mein Herz, das unbändige Ding, Herr bin, wenn ich es sein will, komm; wir wollen unserm Meister diese Nacht verherrlichen . . .
Beide gingen zur „bunten Palette“, holten die Freunde, beriefen ein Dutzend Musiker und zogen vereint mit diesen, große Fackeln und Laternen in den Händen, in Gerard Dows Garten.
Und nun begann ein Musiciren, ein Jubeln unter den Fenstern des gerührten Malers, daß die ganze Nachbarschaft lebendig wurde, auf die Straßen kam und in die allgemeine Freude einstimmte.
Brigitta aber beichtete getreulich ihrem Gatten. Seit dieser Zeit gewann die bisher schon so theure Amati-Geige in seinen Augen einen unschätzbaren Werth und nur mit Rührung ergriff er sie, um ihr die süßen Töne zu entlocken, welche sie in sich verbarg, und als er bald darauf sein eignes Bildniß malte, stellte er sich mit seiner geliebten Geige in dem Augenblicke dar, in welchem er durch ihre Macht seinen höchsten Schatz wieder eroberte.⏎
⏎
==Anmerkung WS==
{{references}}
[[Kategorie:Kunstwissenschaft]]
This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|