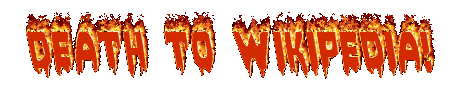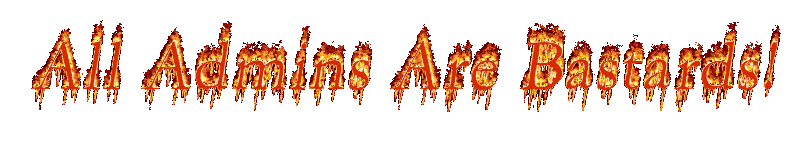Difference between revisions 1993370 and 1993427 on dewikisource{{LineCenterSize|100|23|Der}}
{{LineCenterSize|160|23|'''KUNSTVEREIN.'''}}
{{Linie}}
{{LineCenterSize|100|23|NEUE SERIE:}}
{{LineCenterSize|110|23|''Stahlstich-Sammlung der vorzüglichsten Gemälde''}}
{{LineCenterSize|90|23|der}}
{{LineCenterSize|140|23|DRESDENER GALLERIE.}}
(contracted; show full)
Drei Wochen später verheirathete sich Kaspar Netscher zu Bordeaux mit seiner Retterin. Jetzt mußte er auf seinen und seiner Gattin Unterhalt denken und eine Reise nach Italien war vorläufig unmöglich. Netscher kam nie dorthin.
Wie schon gesagt, kehrte er bald mit seiner Frau nach dem Haag zurück, wo er seine eigentliche Wirksamkeit erst eröffnete. Von jetzt an hieß es: ''Kaspar Netscher ist in Italien gewesen!''
==5
&6. Heft. (Doppelheft)==
===Die Spieler. Von Caravaggio.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 011.jpg|600px|center]]
Wo die Italiener aus ihrer durchschnittlich idealen Richtung in der Malerei heraustreten und sich als Naturalisten und Individualistiker zeigen, da sind sie dennoch in der Wahl ihrer Stoffe, Form und Ausdrücke weit von der Naturalistik der Niederländer entfernt. Beide schreiben das Leben aufs Genaueste ab. Der Niederländer aber schildert, selbst stets unerschütterlich ruhig, vorzugsw(contracted; show full)
Das unstäte und unordentliche Leben dieses Künstlers muß dem Umstande zugeschrieben werden, daß er sehr früh aus dem Vaterhause weichen mußte. Daher rührt wohl auch der Name Bega, unter welchem allein er später gekannt wurde.
Das vorliegende Werk zeigt das Charakteristische des Malers in ausgezeichneter Weise. Während wir die meisterhafte Technik und Naturwahrheit bewundern, können wir nicht umhin, die niedrigen rohen Stoffe, welche er darstellte, unschön und abstoßend zu finden.
⏎
⏎
⏎
⏎
⏎
⏎
----
===Bärenjagd. Von Franz Snyders.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 013.jpg|600px|center]]
Im Herbste des Jahres 1606 sah derjenige Theil des castilischen Scheidegebirges, welcher, nördlich von Madrid gelegen, den Namen Sierra de Guadarama führt, ein Schauspiel, welches ebenso eigenthümlich als glänzend auf diesen wilden Plateaus, in diesen düstern Schluchten wohl nimmer wieder gesehen ward.
Etwa in einer Höhe von fünftausend Fuß über dem Meere hatte König Philipp der Dritte von Spanien sein prächtiges Hoflager aufgeschlagen. Der Hof-Marschall Don Jose de Ximanez hatte einen rings von Abgründen und von Wasserstürzen romantisch umgebenen, von Pinien, Cypressen und mächtigen Korkeichen umkränzten, weiten, ebenen Platz für das Lager ausgewählt. Hier erhob sich das von Goldstickereien prangende Zelt des Königs, von Alt-Castiliens schwerem Seidenbanner überweht, und an diese herrliche, luftige Wohnung schlossen sich in langen, schnurgeraden Reihen die grün und weißgestreiften Zelte des allmächtigen Günstlings und Ministers, Grafen Lerma, sammt denen der Grandezza und der Caballeros del Rey. Ferner hin waren die leichten Wohnungen der Königin und ihres von Schönheit strahlenden Gefolges. Diese Zelte waren in der ebenso reichen als bizarren maurischen Form ausgeführt, und ungeachtet Alt-Castilien sammt dem ganzen christlichen Spanien den unglücklichen Moriscos Verderben und Tod geschworen hatte, sah man doch hier den Halbmond über den Standarten blitzen, welche die Embleme der Omajaden und Abassiden, der Abencerragen und der Zegris zeigten. Fast am Rande einer tiefen Schlucht waren Baracken für die Diener und für die niedere Ritterschaft, so wie für die Jäger errichtet, neben welchen die feurigen Hengste Andalusiens und die sichern Saumthiere von Aragon an eisernen Pfählen festgebunden waren. Ungeduldig und feurig, nach dem Blute der wilden Bewohner des rauhen Gebirgs dürstend, erblickte man in einiger Entfernung vom Lager den Platz, wo Hunderte von Wolfs- und Bären-Hunden grimmig sich zeigten, die kaum durch die schweren Peitschen der Jagdknechte in Ruhe gehalten werden konnten.
Das rührigste Leben herrschte in dieser extemporirten Stadt. Stattliche Herren, geschmückt wie in Aranjuez, durchschritten die Zeltgassen; Gruppen der edelsten Damen Spaniens, reich mit Peru’s Edelsteinen geschmückt, zeigten sich zwischen den wallenden Federbüschen der Caballeros; sie konnten hier scherzen, sie konnten lachen, und ein natürliches Wort sprechen, das sonst nur ihre Liebhaber in verschwiegener Nacht hörten; – denn die mörderisch-steife Etiquette des spanischen Königshofes war auf den ausdrücklichen Befehl Philipps III. diesmal im Schlosse zu Madrid und in Aranjuez zurückgeblieben.
Ueberhaupt hatte Philipp, der sonst gar nicht mehr befehlen konnte, sondern sich gehorsam unter den Willen des Grafen Lerma schmiegte, der, anstatt König zu sein, zu einer kraftlosen, bedauernswerthen Puppe herabgesunken war, seit einiger Zeit ein besonderes Leben entfaltet. Dies Leben, diese Wirksamkeit richteten sich, wie zu erwarten, jedoch durchaus nicht auf den beklagenswerthen Zustand des schon durch Philipp II. tief entwürdigten und dazu ausgesogenen Spaniens, sondern lediglich auf die Art seiner Unterhaltung. Dies war von Philipp schon sehr viel; denn bisher hatte er auch gar nichts wollen können.
Es war ein eigenthümlicher Umstand nöthig gewesen, um den Herrscher zweier Welten aus seiner unwürdigen Lethargie in etwas zu erwecken. Philipp III., wie mehre bessere Regenten Spaniens vor ihm und nach ihm, war ein besonderer Freund der Künste. Eigenthümlicherweise aber besaß dieser Monarch gegen die Schöpfungen der Spanier eine große Abneigung, obgleich damals schon, namentlich zu Sevilla unter Juan de Castillo, dem Lehrer des großen Murillos, sich ein Sprossen spanischer Kunst entfaltete, das späterhin zur schönsten Blüthe gedieh. Philipp II. war der finstere, kalt-grausame Feind seiner braven Niederländer; unter ihm fanden nur wenige Werke niederländischer Maler den Weg nach Spanien. Der dritte Philipp aber schätzte Niederland und seine Künstler um so mehr, als sich die Bande löseten, welche diese Nation an das damalige Mutterland knüpften; sie schien erst Werth für ihn zu erhalten, seit er jeden Augenblick befürchtete, sie vollends zu verlieren.
In jener Zeit eben eröffnete eine Reihe ausgezeichneter Maler die glänzendste Epoche niederländischer Kunst.
Schwach und üppig aber, wie der König von Spanien war, gingen die Schöpfungen des Rubens, der Teniers, des Kaspar de Crayer, des Peter Neefs und Jodocus Momper, ohne Eindruck zu machen, an ihm vorüber. Sein Liebling, sein erklärtes Genie im Malerfache war dagegen Franz Snyders. Die Thierstücke dieses jungen Meisters athmeten die ganze Wildheit, den ganzen entfesselten Naturalismus, dessen der König bedürfte, um sich aufzuregen. Diese blutigen, wilden Thierkämpfe Snyders, wo die Thiere, in ihrer lebendigsten Eigenthümlichkeit aufgefaßt, alle Zustände der thierischen Seele, Muth, Furcht, den bis zur Wuth gereizten Zorn, List und Grausamkeit in den in der höchsten Mannigfaltigkeit glänzenden Gemälden darlegen, fesselten den König so sehr, daß er den Meister von Antwerpen nach Madrid berief.
Franz Snyders war kurz vor der Zeit, die wir vorhin schilderten, in Aranjuez angekommen und von dem Könige mit großer Freude empfangen. Von diesem Augenblicke an phantasirte der König, um Situationen zu Wolfs- und Keiler-Kämpfen zu erfinden; Snyders mußte demgemäß arbeiten. Alles dies genügte jedoch dem Herrscher nicht: „Ein Wolf ist kein edles Thier, der Eber ebenso wenig; Bären, die Könige der Wälder, muß ich auf Snyders Gemälden sehen!“
Graf Lerma widersprach nicht, als Philipp III. erklärte, in der Sierra Guadarama Bärenjagden anstellen zu wollen, um dem Maler aus den Niederlanden Gelegenheit zu geben, das gefürchtete Raubthier in wildem Zustande, in der unbeschränktesten Darlegung seines Naturells zu beobachten. Lerma hatte das Stillschweigen und die Unthätigkeit des Königs auf anderen Gebieten zu nothwendig, als daß er demselben seinen Einfall auszureden versucht hätte. Demgemäß erfolgte die Reise des Hofes in die Sierra Guadarama.
Der Meister selbst, eigentlich die Hauptperson bei dem Unternehmen, nahm sich gegen seine glänzende Umgebung fremdartig genug aus. Snyders war ein mittelgroßer, starkgebauter junger Mann, ernsten, fast schwermüthigen Ansehens, mit untadelhaftem, weißem Teint und hellen Locken. Seine Kleidung war reich, aber dunkelfarbig, wie diejenige seiner Landsleute. Er sah zwischen den grellfarbig geputzten, gelben Spaniern etwa wie Prinz Hamlet neben seiner Umgebung aus.
Eben sein schwermüthiges, poetisches Wesen aber wandte dem Niederländer die Gunst der spanischen Damen zu. Wie manches blitzende schöne Auge ruhte auf Snyders Gestalt mit süßem Wohlgefallen, und suchte dem Schüchternen durch zarte Lockungen zu einer Liebeswerbung Muth einzuflößen. Aber der Meister wandte sich von diesen mutherweckenden, herausfordernden, liebebegehrenden Blicken ab . . . Sein Herz war bereits von dem Strahle eines Auges berührt und tief im Innern getroffen, das, bescheidener und züchtiger als selbst das seinige, dennoch an Schönheit und jungfräulicher Blüthenfrische jedes andere der Damen des Königshofes übertraf. Dies war das Auge von Donna Mencia d’Albucalde. Sie war ein Mädchen von höchstens neunzehn Jahren, schlank, zierlich, fast zu zart gebaut, aber von einer Anmuth, von einem so fesselnden Wesen, daß neben der Jungfrau die gefeiertsten Schönheiten des spanischen Hofes, Donna Isabella Valdellos, Donna Bianca de Spinola, eine Verwandte des berühmten Feldherrn Spinola, der in dieser Zeit eben mit Erfolg gegen Moritz von Oranien in den Niederlanden kämpfte, in Nichts verschwanden.
Fast alle Damen des Königshofes waren von ächt spanischem Adel, das heißt, sie hatten gothisches Blut in ihren Adern. Donna Mencia d’Albucalde, aus Cordova gebürtig, gehörte jedoch von mütterlicher Seite den unglücklichen Moriscos an, deren letzte Reste Philipp III. und Comte de Lerma mit schonungsloser Gewalt von Spaniens Boden zu vertreiben strebten. Donna Mencia besaß die biegsame Taille, das geheimnißvolle glühende Auge der Mauren, und barg in ihrem Busen die volle Gluth des Orientes. Sie war Diejenige, welche der Maler Franz Snyders in verschwiegener Leidenschaft anbetete. Wohl aber hatte Donna Mencia den geheimen Sinn der Blicke des schönen Niederländers zu deuten gewußt. Durch einen unwiderstehlichen Zug des Herzens zu ihm hingezogen, hatte sie auf eben so zarte als innige Weise eine Annäherung bewirkt, und zwei Tage vor der Abreise des Hofes zum Gebirge hatte Snyders ihr seine Liebe – der Glückliche der Glücklichen – gestehen können.
Zugleich aber erfuhr er, welche Hindernisse sich entgegen stellten, wenn er es versuchen würde, Donna Mencia’s Besitz zu erringen. Niemand anders als Graf Lerma war ihr Vormund; dieser hatte bisher das der Donna Mencia gebührende Vermögen sammt den reichen Lehen der Albucalde’s verwaltet, und unermeßlich habsüchtig und geizig, wie der allmächtige Minister es war, hatte er bereits versucht, die Hand darnach auszustrecken, und Donna Mencia zu bewegen, den Schleier zu nehmen.
Mencia d’Albucalde sah in dem geliebten Maler, dem Günstlinge des Königs, ein Werkzeug des Himmels, um sich, abgesehen von ihrer Herzensneigung, gegen die Ungerechtigkeit Lerma’s zu schützen. Snyders hatte nicht sobald diese Verhältnisse erkundet, als er offen von Mencia’s Knechtung durch Lerma bei dem Könige redete. Philipp versprach Abstellung aller Beschwerden der schönen Dame; eine Viertelstunde später aber erzählte er dem Grafen Lerma buchstäblich was zwischen ihm und Franzesko Snyders abgeredet war. Der Graf war wüthend; dennoch traute er seinem wankelmüthigen, nicht selten lügnerischen Gebieter nicht, sondern beschloß, vorerst den Maler auszuforschen.
Die Reise nach Guadarama bot dazu die beste Gelegenheit. Lerma schloß sich an Snyders an, und zog ihn über Ostende’s weltberühmte Belagerung durch Spinola, über Moritz von Oranien, wie über die niederländischen Angelegenheiten in ein Gespräch, wobei er zugleich den Maler in Bezug auf seine Neigung zu Donna Mencia ausholen wollte. Aber der vorhin Arglose war, nachdem ihn die Geliebte angstvoll gewarnt, klug genug ihm auszuweichen, und verstand es zugleich, seine unbesonnene Unterredung mit Philipp III. von einer ziemlich unverdächtigen Seite darzustellen.
Graf Lerma wußte nicht, was er denken sollte. Soviel war ihm indeß als ausgemacht, daß Donna Mencia nicht von seiner Gewalt frei werden und nicht zum Besitz ihrer Güter gelangen sollte, in welchen sie bei ihrer Verheirathung eintreten mußte. Der Spanier beschloß zu beobachten, um Donna Mencia’s Neigung zu ergründen, und dann erst zu handeln.
Die Liebe des schönen Mädchens sollte ihm bald enthüllt werden. Am zweiten Morgen, nachdem das Lager im Gebirge aufgeschlagen war, machte sich der Gallego, ein scharfer Nordwind, auf und strich mit ungewohnter, fast winterlicher Kälte über die Felsen des Gebirges. Die Jäger bezeichneten diesen Tag als einen solchen, an welchem der Bär, der die Wärme scheut, das Lager am liebsten verläßt, um auf Streifereien auszugehen. Demgemäß ward die Meute in Bereitschaft gesetzt, die Rosse wurden gesattelt, die ganze hohe Gesellschaft, den König, den Grafen Lerma und den Maler Franz Snyders an der Spitze, schwang sich auf die Thiere und drang, von den Jägern geführt, muthig und gut mit langen Bärenspießen bewaffnet, durch Schluchten und escarpirte Wege aufwärts in die Sierra vor. Die Damen beschlossen den Zug und unter ihnen strahlte, wie der Mond unter den Sternen, Donna Mencia, welche, die Augen unverwandt auf den Niederländer gerichtet, heute wie von einer trüben Ahnung befangen schien.
Die Jagdgesellschaft war auf einem von Bäumen entblößten Plateau in der Nähe eines Wäldchens angekommen, in welchem ein gewaltiges Bärenpaar nach den Aussagen der Jäger sein Lager hatte. Die Ritter und Jäger schlossen einen Halbkreis, hinter welchem sich die Damen aufstellten, und die Jäger voran, rückte die Truppe nicht ohne ängstliche Spannung vor, um das Gehölz abzutreiben und die Ungethüme aufzujagen. Die Meute war etwa 50 Schritt hinter dem Halbkreise aufgestellt, um sofort hervorzubrechen, wenn sich der Bär zeigen würde.
Unter dem Schmettern der großen Hifthörner wollte die Gesellschaft eben in den Wald dringen, da erhob hinter ihrem Rücken die Rüdenschaar ein furchtbares, wildes Geheul. Betroffen wandten sich Aller Blicke rückwärts – da sahen sie, wie ein furchtbar großer Bär, der, vermuthlich von dem Lärm eingeschüchtert, sich so lange verkrochen gehalten hatte, aus einer bisher unbeachteten Felsenschlucht hervorstürzte, und die blitzenden Augen um sich werfend, die Stelle suchte, wo er sich retten konnte.
Philipp sprengte vor und gab Befehl; da wurden die Hunde losgekoppelt und etwa sechs der stärksten und grimmigsten packten in der nächsten Secunde den zottigen Pelz des Bären. Er erhob sich wild auf die Hinterfüße, und streckte mit jedem Schlage seiner mächtigen Tatzen einen der blutlechzenden Feinde nieder. Dann machte er sich durch eine Gewaltanstrengung los und rannte blind vor Zorn und ängstlicher Wuth geradewegs auf die Jagdgesellschaft an. Da die Damen sich jetzt in der Vorderreihe befanden, so waren sie seinem Anlaufe zuerst ausgesetzt; sie suchten die von dem wilden Schauspiele scheu gewordenen Rosse zu wenden, indeß die Herren vorzudringen strebten; die Folge war eine allgemeine Verwirrung, noch durch das Angstgeschrei der Damen vergrößert.
Jetzt kam der Bär heran; vier Hunde, die sich in seinem Nacken und seinen Flanken festgebissen hatten, mit sich schleppend. Er stürzte mitten unter die Pferde. Indeß die Rosse entsetzt auseinanderstoben, scheute sich Donna Mencia’s feuriger andalusischer Zelter, bäumte sich und schlug über. Die Dame selbst befand sich keine fünf Schritte von dem Bären. Sie hob die Hände empor und gab sich verloren.
Als sie jedoch die Augen wieder öffnete, stand Franz Snyders zwischen ihr und dem Ungethüm.
Das gezückte Schwert in der Rechten, sprang er, ein wahrer Matador, vorwärts und bohrte die zweischneidige flamändische Klinge dem Raubthier durch das Genick. Sterbend brach dasselbe zusammen. Dies war so schnell geschehen, daß sich die Herren mit ihren Speeren kaum noch von der Ueberraschung erholt hatten, worein sie das plötzliche Vordringen des Thieres versetzte.
Während jetzt ein lautes Halali erscholl, von dem Schmettern der Jagdhörner übertönt, beugte sich Snyders, von dem Augenblicke hingerissen und in seiner Aufregung Alles außer seiner Liebe vergessend, nieder, hob Donna Mencia zu sich empor und schloß die Gerettete, die sich leidenschaftlich an ihn anschmiegte, inbrünstig in seine Arme.
Philipp III. stieg vom Pferde und begrüßte den tapfern Niederländer mit lebhaftester Freude. Auch der finsterblickende Graf Lerma trat herzu und gab ihm seinen Glückwunsch. Im Triumphe, reich mit Baumzweigen bedeckt, ward das edle Wild nach dem Lager getragen; ein Fest ward hier veranstaltet, auf welchem Snyders bereits die Skizze des Thierkampfes dem entzückten Könige vorlegen konnte. – Als Jeder den Entwurf bewunderte, sagte Lerma mit Betonung:
„Schade, Sennor Snyders, daß Ihr nicht auch das Talent besitzt, Figuren auf Eure Gemälde zu bringen, welche der Vortrefflichkeit Eurer Thierzeichnungen gleichkommen. Ihr hättet sonst in der Scene von gestern mit der Donna Mencia einen unübertrefflich schönen Stoff, der Euch um so mehr begeistern müßte, als Euer Herz dabei ins Spiel gekommen ist.
Snyders erröthete tief: das Geheimniß seiner Liebe war verrathen, und mehr bedurfte es bei dem mächtigen, finstern Grafen Lerma nicht, um die kaum geknüpften Bande zweier liebenden Herzen mit unerbittlicher Faust zu zerreißen . . .
Gleich nach der Rückkehr des Hofes nach Aranjuez setzte er es bei dem schwachen Philipp durch, daß Donna Mencia d’Albucalde in das Kloster zum Herzen Unsrer lieben Frau der Rettung in Sevilla geführt wurde, wobei der Habsüchtige sich zugleich des größten Theils der Besitzungen seiner unglücklichen Mündel bemächtigte.
Franz Snyders malte außer dem Bärenkampfe nur noch einige Stücke für Philipp III. Dann kehrte er traurig in die Heimath zurück. Es litt ihn, seit Donna Mencia ihm verloren ging, nicht mehr in Spanien.
----
===Die Wahrsagerin. Gemälde von Franz van Mieris.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 014.jpg|500px|center]]
Im Jahre 1667 war „Whitehall“, London, glänzender, als vielleicht jemals später.
König Carl II., oder richtiger seine Freundin, die schöne Herzogin von Portsmouth, berüchtigten Andenkens, hielt in Whitehall Hof und hier war’s, wo die ungeheuren Summen verschwelgt wurden, die Carl dem Parliamente abpreßte.
England war in Gefahr, aber in Whitehall lachte man darüber. Frankreichs Flotte unter D’Etrées, Hollands stolze Segler unter de Ruyter und Cornelius de Witt herrschten auf den Meeren. Der britische Stolz empörte sich gegen die Demüthigungen, welche England, nicht etwa durch seine Schwäche, sondern durch das Verschulden seines Monarchen erlitt.
Carl II. dagegen ließ sich darüber durch die frivolen Witze seiner ausschweifenden Gesellschafter so gut als möglich trösten. Dennoch war er nicht ganz und gar so unverschämt, um nicht immer noch etwas thun zu wollen. Er verlangte, als die Friedensunterhandlungen zu Breda zwischen England und den Niederlanden einen zweifelhaften Erfolg in Aussicht stellten, vom Parliamente außerordentliche Credite, um die fast bedeutungslos gewordene englische Flotte gegen die Generalstaaten in wehrhaften Stand zu setzen. Das Parliament, schon hundert Mal durch Carl’s Vorgeben getäuscht, bewilligte abermals die Summe, welche der König verlangte, obgleich voraus zu sehen war, daß diese Gelder der Flotte nicht zugewandt, sondern in größter Geschwindigkeit verschwendet werden würden. Dieser letzte Umstand ließ wirklich nicht lange auf sich warten.
Ein prächtiges Fest der Herzogin von Portsmouth war zu Ende. Die Geladenen entfernten sich; denn es war fünf Uhr Morgens. Die Königin dieser Nacht verschwand. Man sah in den Sälen nur noch Carl II. mit seinen vornehmsten Günstlingen wie Leute auf- und abwandeln, die durchaus nicht wissen, was sie anfangen sollen.
Der König, schwarz gekleidet – eine elegante Figur mit einem unschönen, von Leidenschaften durchfurchten, blassen Gesichte – hatte den schwarzseidenen Hut mit der schneeweißen Feder tief ins Gesicht gezogen. Er sagte kein Wort und sah, ungeachtet der frivolen Witze des Cavaliers, welchem er seinen Arm gegeben, sehr schwermüthig aus.
Dieser Mann war John Wilmot, der durch seine Satyren, seinen Atheismus, sein ausschweifendes Leben, durch seine Verführungskünste, Frauenzimmern gegenüber, und vielleicht auch durch seine Bekehrung berühmt und berüchtigt gewordene Graf von Rochester. Rochester war noch jung und besaß ein einnehmendes Gesicht, das durch den gänzlichen Mangel an Bart etwas Weibisches erhielt. Er war ganz in weiße, schwer mit Gold gestickte Seide gekleidet und augenscheinlich etwas berauscht.
Neben John Wilmot ging Blood, „dieser vollkommene Bösewicht in Priesterkleidung“, wie ihn Rochester in seiner großen Satyre nennt, salbungsvoll blickend und zweideutige Witze mit großer Fertigkeit reißend. Blood hatte Antony Ashley Cooper, Grafen von Shaftesbury, dieser den Herzog von Buckingham am Arm. Letzterer war ein vollendeter Hofcavalier, der würdige Freund Lord Rochesters.
Nie waren diese Herren ernst, als wenn die Guineen anfingen zur Neige zu gehen. Da sie jetzt ungeheuer ernst waren, so mußte in ihren Börsen oder vielmehr in der Börse des Königs totale Geldebbe eingetreten sein.
– Alles ist zu Ende! sagte Carl II. zu John Wilmot, welchen stets das Geschäft traf, den weiten Schlund von Zeit zu Zeit zu füllen, welcher die Chatouille des Königs hieß. Wir haben nichts, als Unsern Brillantring hier am Finger, und doch müssen Wir Geld haben . . .
– Die goldene, mit Diamanten verzierte Kapsel, in welcher das Bürgerdiplom von London für Eure Majestät eingeschlossen war, hilft über einige Schwierigkeiten hinweg, sagte Rochester.
– Ach, diese phantastische Idee des Lordmayours war zu komisch, flüsterte der König. Wir haben die Kapsel daher ihr gegeben . . .
– Der Herzogin von Portsmouth? rief John.
Carl nickte und Rochester summte das Lied: <tt> „Go away my Wealth and fortune etc.“ </tt>
– Wißt Ihr verwünschten Vampyre, fragte Carl jetzt sehr finster, wieviel Ihr mir binnen acht Tagen verschlungen habt?
– König Carl, sagte der Bischof Blood, welcher ihn am unverschämtesten bestahl, ich habe seit vier Wochen gefastet.
– Dafür hast Du gestern auch eine Mahlzeit von sechstausend Pfunden gethan! erwiderte Carl . . . Deine Schulden, Mylord John, habe ich bezahlt und, Christi Blut! welche Schulden! . . . Shaftesbury, Gott wolle Dir gedenken, was Du mir für Deine vier römischen Feste in Ashley-House abgepreßt hast. Ich glaube, Cooper, Du bist der schändlichste, leichtfertigste Patron in Unserm Königreiche.
– Mit Eurer Majestät Erlaubniß, antwortete der witzige Shaftesbury, wenn Sie von Ihren Unterthanen reden, glaube ich selbst, daß ich es bin, ohne jedoch Lord John damit zu nahe zu treten.
– Und du, Buckingham, fuhr Carl fort, Du hast mir Gelb geliehen, aber Du hast mich im Spiel betrogen, hast, als ich Dir meine Karte übergab, auf dieselbe, auf meine Rechnung, fünfzehnhundert Guineen an Blood verspielt, um nachher die Beute mit ihm zu theilen . . . Was kann ein König, von solchen Haifischen umlagert, thun? Verdient Ihr nicht, daß ich Euch in den Tower sperren, oder besser, auf offenem Markte henken lasse? Schafft mir jetzt mein Geld wieder: ich rathe es Euch! Alles, was das Parliament zur Ausrüstung meiner Flotte bezahlte, habt Ihr verschlungen . . .
–Der keusche, fromme, kluge Carl ist zu bescheiden! erwiderte Rochefter hämisch.<ref> Worte der berüchtigten Satyre Wilmots: „Die Geschichte der Albernen“.</ref>
– England ist wehrlos . . . Wenn van Gent, Ruyter und de Witt mit ihren siebzig Kriegsschiffen kommen: soll ich Euch Schurken hinstellen, um diese Niederländer von der Themse zurückzutreiben? Schafft mir Geld, oder die Holländer vom Halse, sonst geht’s Euch übel!
Blood und Shaftesbury hatten sich still fortgeschlichen.
– Wir werden Geld haben, Sire, und diese Holländer werden nicht kommen! sagte John Rochester endlich. Gieb mir Vollmacht, König Carl, und unsere Engländer sollen keine holländische Flagge, wohl aber gute holländische Ducaten sehen.
– Willst Du nach Breda, um an den Friedensunterhandlungen Theil zu nehmen? fragte Carl.
– Segne mich Gott, daß ich mich nicht in diese ehrwürdige Gesellschaft mische! rief John. Ich gehe in vertraulicher Sendung zum Rathspensionair Cornelius de Witt zum Haag, verspreche ihm, was Du willst, und borge von ihm so viel Geld, als Du bedarfst. Es kommt England ja, beim Kreuz! auf einige schlechte Inseln und so weiter nicht an!
Carl schämte sich anfangs, willigte aber dennoch, leichtfertig wie er war, in Rochesters abenteuerlichen Plan ein. Lord John, dem das Extravagante desselben im Herzen kitzelte, erklärte, keine Minute säumen zu wollen, sondern sich, und wenn es in dem seidenen Ballkleide sei, sofort zu dem holländischen Rathspensionair zu begeben. Carl gab ihm ein Handbillet und <tt>carte blanche,</tt> und John bog das Knie, um sich feierlich zu beurlauben.
Bereits aber hatte Rochesters Ernst dem bleichen Könige zu lange gedauert. Er ward unruhig, dann sagte er in seinem leichtfertigen Tone: Aber Du wirft doch, bist Du in Holland, an Unsere <tt>petits plaisirs</tt> denken, John?
– Ohne Zweifel, Majestät! Ich werde nämlich nicht zurücklehren, ohne Euch die schönste Dame Hollands vorzustellen.
– Du bist bekanntlich mein Fanfaron! rief Carl aufgeweckt. Aber hältst Du Wort, so wollen Wir Dich königlich belohnen. Machst Du den Frieden und bringst Du Uns Geld und führst Du die Schönste Hollands nach Whitehall: so sollst Du zum ersten Herzoge Englands nach dem Kronprinzen ernannt sein.
– Die Sache interessirt mich! bemerkte Buckingham. John ist der Mann, sie anzugreifen; aber ich wette tausend, nein, zweitausend Pfund Sterling, daß er nichts, gar nichts ausrichtet, sondern gegentheils Alles verdirbt, was zu verderben ist . . .
– <tt>Well!</tt> rief Rochester im Abgehen. Wir werden ja sehen! <tt> Dieu et mon bonheur, pas mon droit!</tt> Buckingham, auf die Versprechung des geizigen Königs Carl rechne ich nicht; aber Deine zweitausend Pfund, Bothwell, sind, wie die Seele eines Juden, verloren! <tt>Fare well! </tt>
Einige Tage später landete John Wilmot im Haag und begab sich sofort zum Palaste des Rathspensionairs.
Cornelius de Witt, ein hagerer, eiskalter Holländer, wußte zuerst nicht recht, was er aus dem beweglichen, zierlichen John Wilmot machen sollte. Er schien nicht zu begreifen, daß man einem solchen Hasenfuße eine höchst wichtige, vertrauliche Mission hatte übertragen können, die dem Unterhändler durchaus freie Hand ließ. Rochester indeß wußte den Seemann dennoch mit bekannter Kunst einzunehmen, und obwohl de Witt vorsichtig nur einen Schritt nach dem andern in der Unterhandlung weiter ging, so gestand sich John Rochester dennoch entzückt, daß diese Viertelstunde mehr Resultate als die dreimonatlichen Berathungen der zu Breda streitenden Diplomatie aufzuweisen habe. Rochester, der feilste Höfling, war dennoch, dem gesunden Kern seines Wesens nach, ein durchaus republikanischer Geist, wie die meisten seiner Gedichte bezeugen. Wie hätte de Witt dem interessanten, geistreichen Taugenichts<ref> Rochester hatte wirklich den corrumpirt-italienischen Spitznamen: <tt>Tunnicotto! </tt> Thunichtgut!</ref> widerstehen können, als derselbe declamirte: „So lebe denn wohl, geheiligte Majestät! Alle Tyrannen werden in den Staub zu Füßen des Thrones gestürzt werden! ''Wo Menschen frei geboren sind und noch frei leben, da ist jedes Haupt ein gekröntes!<ref> Schlußstrophe der Satyre: „Die Wiedereinsetzung.“</ref>
– König Carl will Geld! war der Refrain des Lords.
– Holland will Land und Leute in Bengalen, Bahar und Crixa, sammt Aufhebung der Monopole, und dann fordere König Carl II. was er will; wir bezahlen! erwiderte de Witt. Wir sind also der Hauptsache nach einig . . .
Einige Minuten später waren die beiden Männer jedoch aufs Heftigste entzweit. Rochester nämlich konnte sich immer nur eine Zeit lang vernünftig benehmen, dann brach sein Leichtsinn, seine Leidenschaftlichkeit, sein liederliches Wesen nur desto stärker hervor. Lord John war nur allzulange vernünftig gewesen; der Vulkan bedürfte einer Eruption. Es fehlte blos noch eine Gelegenheit, damit die verderbliche Seite des Lords sich in ihrer vollen Ausdehnung geltend machte. Unglücklich genug zeigte sich diese, als John Wilmot die Gemächer des Rathspensionairs verließ, eben in dem Augenblicke, als der Cavalier sich mit großer Selbstzufriedenheit, mit wahrem Vergnügen gestand, daß er gegen den ehrwürdigen Holländer sich excellent und als ein ganzer Mann benommen habe.
Rochester ging die mit prächtigen Gemälden gezierte Gallerie hinab, da öffnete sich eine Thür zu seiner Seite; schwere Seide rauschte, und die Secunde darauf stand unmittelbar vor dem Engländer eine Dame von solcher bezaubernden Schönheit, daß Rochester, unfähig, einen Schritt vorwärts zu machen, wie eine Bildsäule stehen blieb. Hoch und schlank von Wuchs war diese Niederländerin ein vollendetes Weib von etwa zweiundzwanzig Jahren, mit strahlenden, sehnsuchtsvollen, blauen Augen, mit dem reizendsten, zum Herzen sprechendsten, von prächtigem, krausem Blondhaar umgebenen Antlitze von der Welt. Sie betrachtete den schönen Engländer einen Augenblick, wie es schien, nicht ohne Wohlgefallen, dann grüßte sie ihn mit offenem Lächeln. Dieses Lächeln hatte aber noch gefehlt, um Lord John um den Verstand zu bringen. Der Eindruck, welchen die Dame auf den leidenschaftlichen, wüsten Hofmann machte, ward so stark, daß sich Rochesters Gesichtsfarbe veränderte; sie ward bleich, während seine braunen Augen zu blitzen begannen. Er trat rasch auf die junge Dame zu, ergriff ihre schöne Hand, stammelte einige Worte und preßte einen langen Kuß auf ihre Finger. Rochester bemerkte gar nicht, welche Anstrengungen die Schöne machte, um sich ihm zu entziehen; er besann sich erst, als die Bestürzte mit lauter Stimme nach ihren Dienern rief, um sich von dem Ungestümen zu befreien. – In der Minute darauf stand Cornelius de Witt vor dem Engländer, welcher inzwischen auf die Kniee niedergesunken war, der Rathspensionair ergriff die Dame am Arme, befreite sie von dem Lord und stand, heftigen Zorn in jeder Miene zeigend, dem Unbesonnenen gegenüber.
– Ihr seid kein Cavalier! rief de Witt außer sich. Ihr seid ein Elender! Entfernt Euch auf der Stelle und verlaßt das Land, dem Burschen Eures Gelichters nur Schande und Schmach bringen können! Verweilt Ihr, der Ihr Euch Graf Rochester nennt, auf holländischem Gebiete noch vierundzwanzig Stunden, so lasse ich Euch aufknüpfen!
John hatte inzwischen seine Fassung wiedergewonnen. Er warf noch einen Blick auf die eben am Ende der Gallerie verschwindende Dame, sandte ihr Kußfinger hinüber, hing sein Schwert nachlässig zurecht und verbeugte sich vor dem Niederländer mit höhnischem Lächeln.
– Ich bitte um Verzeihung, guter Freund, sagte er abgehend; ich hatte vergessen, daß ich mich im Lande der Wallrosse und Seehunde befinde, die natürlich noch keine Galanterie studirten. Uebrigens versichere ich Euch, mein ehrenwerther Mynheer, daß mich weder Eure Stricke noch Eure Schwerter abhalten sollen, mich hier so gut als möglich zu unterhalten . . .
John reisete nicht ab, indeß hielt er es für gut, sich zu verbergen. Er war fest entschlossen, nicht von dannen zu gehen, ohne sich der königlichen, schönen Dame im Palaste de Witts bemächtigt zu haben. Er unterhielt sich mit seiner dicken Wirthin und erfuhr, daß diese keine andere, als Minna de Witt, die Tochter des alten Helden selbst gewesen sei. Wie aber sich ihr nähern? Rochester, der Vielgewandte, brachte durch seine Fragen heraus, daß sich in dem Fischerdörfchen am Strande, jetzt das reizende Scheveningen, eine Frau befinde, welche die ausgezeichnetste Geschicklichkeit besitze, heimliche Liebschaften und Rendezvous zu vermitteln. An demselben Abende stand Rochester vor der niedrigen Hütte des Weibes und trat bei ihr ein. Er fand eine alte, ungewöhnlich schlau blickende Sibille, Mara mit Namen, eine Jüdin, die außer sonstigen mystischen Künsten sich vortrefflich auf das Kartenschlagen und auf das Wahrsagen aus der Hand verstand.
– Wen willst Du sehen und sprechen? fragte die alte Hexe.
– Minna de Witt!
Mara schlug die Hände über die Brust und schwieg unverbrüchlich. Rochester hielt es für nothwendig, ihr durch eine Banknote die Sprache wiederzugeben.
– Gut, sagte sie. Du bist ein Edelmann und zwar ein englischer; nimmer noch habe ich so viel Geld auf einmal in der Hand gehabt, als heute Abend. Zur Gehenna denn mit dem armen Capitain Brakel, der mir kaum noch für ein Glas Tafia bezahlt hat.
Jetzt folgte ein Geständniß der Jüdin.
Minna de Witt unterhielt schon seit längerer Zeit ein zartes Verhältniß mit dem Seecapitain Brakel, einem tapfern, kenntnißreichen Offizier, dem aber der alte Cornelius de Witt, eben seiner niedern Herkunft und seiner Armuth wegen, von ganzem Herzen abgeneigt war. Diese Abneigung hatte sich in tödtlichen Haß verwandelt, seit der Seemann seine Augen auf die Tochter des Rathspensionairs zu werfen gewagt hatte. Mara war die Zwischenträgerin, der <tt>Postillon d’amour </tt> gewesen; hier in dieser Hütte sah die liebliche Niederländerin oft den Geliebten, ebenso oft schlich sich die Jüdin nach dem Palaste, um der schönen Minna de Witt Nachrichten zu bringen, oder um ihr die Karte zu schlagen, wo sich der von den Wogen geschaukelte Freund ihres Herzens befinde und wann endlich das Glück die Thränen dieser Liebe verwischen werde.
John Wilmot konnte sich bei dieser Nachricht kaum enthalten, die Alte zu umarmen. Sie mußte sich neben ihn setzen und Beide fingen einen Plan zu besprechen an, welcher darauf hinaus lief, daß Rochester Minna de Witt noch in dieser Nacht entführen, auf sein Rennschiff bringen und mit ihr nach England unter Segel gehen wollte. Der Don Juan schrieb, als ihm Mara die Handschrift Brakels zeigte, einen Brief an die Schöne, in welcher er möglichst genau des Holländers Schriftzüge nachbildete, und worin er dieselbe um eine Zusammenkunft beschwor.
Mit diesem Briefe machte sich die Jüdin, einen weiten schwarzen Ueberwurf umschlagend und ihren Krückenstock in die Hand nehmend, auf den Weg nach de Witts Palaste.
Rochester, seinen Mantel hoch hinaufschlagend, folgte ihr und blieb an den Blumengärten vor einer Seitenpforte, harrend des Ausganges, stehen. Die Jüdin schlüpfte mit großer Gewandtheit an der Mauer fort und kam in den weiten Corridor, auf welchen Minna’s Zimmer mündeten. Lautenklänge tönten aus der geöffneten Thür; hinter einem aufgeschürzten Vorhange, mit dem Rücken nach dem prächtigen Kamine gewandt, an welchem eine liebeathmende Devise des alten Horaz sich zeigte, saß Minna, halb über einen Tisch gelehnt, und sang eines der sanften Liebeslieder Italiens. Minna war reizender als je. Das Haar war mit Perlen durchflochten, eine Robe von weißem Atlas und ein kurzes Oberkleid, welches oben nachlässig verschoben war und den schwanengleichen Busen zeigte, ließen ihre Schönheit, den reinen Glanz ihres Nackens und ihrer halbnackten Arme strahlender als je erscheinen.
Als Mara erschien, legte sie rasch das Notenbuch und die Laute auf den Tisch und streckte nach dem Brief beide Hände aus. Sie zitterte, sie legte die Hand auf die Augen; sie war so bewegt, daß die Alte heimlich über ihre Besorgniß lächelte: Minna möge entdecken, daß Niemand weniger als Capitain Brakel der Schreiber dieser Zeilen sei.
– Ich soll ihn also sehen! flüsterte Minna, die Hand auf das pochende Herz legend. Und dennoch, warum bin ich heute Abend so beklommen, so unruhig? Welches Unheil droht mir oder dem Geliebten? Meine Zukunft ist finster; ich lebe wie in einem Gefängnisse, und bange vor der nächsten Stunde.
– Zeige mir doch Deine Hand, schönes, stolzes und doch so furchtsames Mädchen! bat Mara schmeichelnd, indeß sie sich der Linken Minna’s bemächtigte.
Nachdem sie dieselbe aufmerksam geprüft, sagte sie, einen Schritt zurück und hinter den Tisch tretend, indeß Minna, den Kopf mit der Hand stützend, sie träumerisch anblickte:
– Merk’ Dir’s, Schönste, Dein Zagen und Zaudern muß aufhören. Bist Du nicht des kühnen Cornelius de Witt Tochter? Und Du wolltest keinen, der Kühnheit Deines Vaters würdigen Entschluß fassen können? Hier in Deiner Hand steht klar geschrieben: Du wirst nimmer glücklich, bevor Du nicht entführt wirst. Laß Dich entführen, Minna, heute Nacht noch, und Deine Sehnsucht nach Liebe und Heirath ist erfüllt! Folge mir; der Capitain erwartet Dich!
– O, nie werde ich dies eingehen! flüsterte Minna. Aber obgleich sie zauderte, so schlug sie doch den Mantel um und ging, zwar bebend aber doch entschlossen, der verschmitzten Wahrsagerin nach. Vor der Pforte empfing sie Rochester.
– Ruhig! murmelte dieser, vor innerer Erregung noch heftiger als Minna zitternd. Capitain Brakel und ich sind Kameraden. Nur muthig voran!
Minna preßte den Brief in ihrer Hand; sie bekam dadurch wieder Muth: – Er erwartet Dich! sagte sie leise.
Am Strande von Scheveningen aber erwartete sie nicht der Geliebte, sondern acht kräftige Matrosen von London, deren Boot auf den kurzen Wellen am Gestade tanzte. Auf Johns Befehl ergriffen diese die junge Dame und trugen sie in das Boot, während Rochester die alte, ziemlich erstarrte Mara mit einem Faustschlage betäubt zu Boden streckte, damit sie nicht etwa zu frühzeitig Lärm mache. Dann lief John bis an den Gürtel ins Wasser, stieg ins Boot, befahl zwei straffen Burschen, die schöne Beute rücksichtslos festzuhalten, und nahm das Steuer. Einige Minuten später lag das Boot neben dem schlanken Yachtschiffe König Carls II.; die Mannschaft brachte die Niederländerin an Bord und führte sie unter Rochesters Beistande in die Cajüte. Dann ward der Anker gelichtet und der Abenteurer stach, außer sich vor Entzücken, in See. Noch aber war der Morgen nicht angebrochen, da segelte eine niederländische Fregatte heran und sandte über die Mastspitze des englischen Schiffes eine Kanonenkugel. John Wilmot befahl dem Capitain beizulegen. Die Holländer kamen heran; auf dem Verdecke der Fregatte zeigte sich ein stolzer, bärtiger Seemann, welcher die Engländer zu examiniren begann. Minna war bis jetzt in die Ruhe der Verzweiflung versunken gewesen. Sie hatte sich eines Hirschfängers bemächtigt und dem Grafen geschworen, sich damit zu durchbohren, wenn er wagen würde, sich ihr zu nähern. Jetzt aber, bei der Stimme des holländischen Capitains gerieth sie außer sich. Sie schleuderte Rochestern, der ihr den Weg versperrte, zur Seite, blickte aus der Stückpfortenluke und rief:
– Moritz! Moritz! Rette mich; ich sterbe!
Der Capitain schien sie zu erkennen; er rief; er drohte; er befahl den Engländern beizulegen; aber das Examen war beendigt, das Rennschiff war wieder unter Segel und Rochester lief zu Deck, damit alles Leinen ausgespannt werde, um der Fregatte zu entkommen. Die Yacht erhielt einige von den vielen auf sie abgefeuerten Kanonenschüssen, gewann aber bei Wind und Wasser Raum und ließ die Fregatte hinter sich. Capitain Brakel signalisirte zur Rhede hin und setzte seine Lantsche aus, um van Gent Rapport zu geben, dann machte er Jagd auf den Engländer.
Cornelius de Witt aber ging bei der furchtbaren Nachricht vom Verschwinden seiner Tochter sofort unter Segel, zog Ruyter an sich und erschien dicht hinter dem Capitain Brakel, welcher Rochestern vergeblich verfolgt hatte, vor Koningsdiex, dann in der Mündung der Themse und zwar mit sechs Kriegsschiffen. Brakel erreichte Rochesters Yacht vor Sheerneß; der Graf kam schwimmend ans Land, während der Holländer das Schiff und seine stolze, kühne Geliebte nahm. An ihrem Arme betrat Moritz Brakel das Verdeck des Cornelius de Witt, welcher dem Braven um den Hals fiel und in der Freude seines Herzens rief:
– Du hast sie zu guter Prise gemacht, Du hast sie den Händen dieses Bösewichts entrissen: Minna de Witt sei die Deine . . .
König Carl und Buckingham und Shaftesbury waren zu Sheerneß, als der Graf Rochester, triefend wie eine Meerkatze, aufs Schloß kam. Das Bombardement begann soeben und Carl II., kein Freund von dergleichen Spielen, war im Begriff, sich mit seinen Begleitern und Dienern in die bereitstehenden Kutschen zu werfen.
John erschien.
– Wo ist der Friede? rief ihm Carl wüthend entgegen, auf eine über den Schloßhof in weitem Bogen hinsausende Bombe zeigend.
– <tt>Ah, Devil! </tt> Devil! rief Rochester.
– Wo hast Du die Dukaten der Holländer, Bajazzo?
– König Carl, höre mich doch! rief Rochester, während Buckingham unmäßig lachte.
– Wo ist die Schönste der Schönen Niederlands? rief Carl abermals.
– Das war’s eben! erwiderte Rochester. Und hätte ich nur gesiegt in dem einen Punkte, so wollte ich ruhig sterben . . .
– Fahr zu, Kutscher! rief der König, und die Wagen rollten fort, indeß der triefende Rochester allein stehen blieb.
Hierauf machte John die furchtbare Satyre: ''„Die Wiedereinsetzung, oder die Geschichte der Albernen“'' gegen König Carl, weshalb er auch lange Zeit in Ungnade fiel.
Die Holländer aber kamen bekanntlich bis Upnore hinauf. Brakel war derjenige, welcher über die bei Medway über den Fluß gespannte Kette segelte und eine Fregatte eroberte.
Nach der Heimkehr der Flotte in den Texel verheirathete sich der Capitain mit der Geliebten. Minna de Witt aber ließ sich zum Andenken an den von der Wahrsagerin herbeigeführten Umschwung ihres Lebens sammt der Jüdin, die dennoch richtig prophezeihte, in eben der Situation malen, welche dem Augenblicke ihres Scheidens aus dem väterlichen Palaste vorherging.
----
{{References|LIN}}
==Anmerkung WS==
{{references}}
[[Kategorie:Kunstwissenschaft]]
This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|