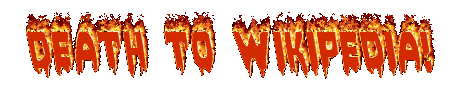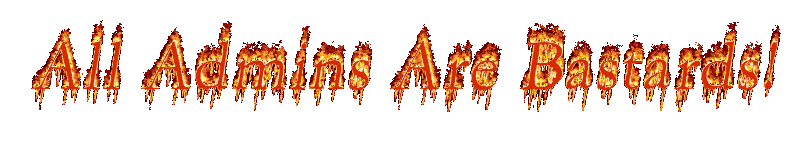Difference between revisions 1996123 and 1997097 on dewikisource{{LineCenterSize|100|23|Der}}
{{LineCenterSize|160|23|'''KUNSTVEREIN.'''}}
{{Linie}}
{{LineCenterSize|100|23|NEUE SERIE:}}
{{LineCenterSize|110|23|''Stahlstich-Sammlung der vorzüglichsten Gemälde''}}
{{LineCenterSize|90|23|der}}
{{LineCenterSize|140|23|DRESDENER GALLERIE.}}
(contracted; show full)
Katharina aber verlobte sich mit dem schönen Sohne eines der reichsten Amsterdamer Rathsherren.
Glücklicherweise waren beide Liebhaber so weit gekommen, um sich vorläufig durch ihre Erfolge in der Kunst über den Verlust einer der schönsten Töchter Niederlands nach und nach zu trösten.
==20.&21. Heft. (Doppelheft)==
===Loth und seine Töchter. Von Guercino da Cento.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 052.jpg|600px|center]]
Guercino, das heißt der Schielende, ist der Beiname des Malers, welcher Giovanni Francesco Barbieri hieß. Er war zu Cento, in der Nähe von Ferrara, im Jahre 1590 geboren und starb im Jahre 1666 zu Bologna. Die künstlerische Ausbildung dieses Meisters bietet dem Forscher interessante Umstände dar. Es ist gewiß, daß Barbieri nur durch eigene Kraft zu dem bedeutenden Künstler wurde, als welchen wir ihn anerkennen; denn der Unterricht, welchen er von Cremonini empfing, möchte nur wenig fördernd auf ihn eingewirkt haben. Selbst sein späterer Meister, wohl der einzige, welcher diesen Namen verdient, Benedetto Gennari, sein Schwiegervater, hat nicht den geringsten ersichtlichen Einfluß auf die Manier, in welcher Guercino malte, ausgeübt. Ein Schüler der Caracci war dieser Maler nie in dem Sinne, daß er ihre Akademie besuchte.
Dennoch eignete er sich die eklektische Methode der Caracci mit der richtigen, fast rigorosen Zeichnung, der klaren, kräftigen Färbung vollständig an und malte eine längere Zeit in diesem Style. Sein Geist war jedoch zu lebendig, als daß er das „Gehaltene“, welches in der Weise der Caracci liegt, nicht hätte überspringen sollen. Caravaggio hatte seine Blüthe erstiegen und seine Bilder voll Leidenschaft und schlagenden Effecten rissen den Guercino in diese neue Bahn. Jetzt ward seine Correctheit inhaltsreicher, die Formen lebensvoller, die ganze Manier breiter und die Färbung mannigfaltiger und brillanter. Obgleich wenig idealisirend und die Natur gleich dem Caravaggio meistens nur schlechthin auffassend, zeigen Guercino’s Bilder aus dieser Periode eine bedeutende Kräftigkeit, Wahrheit und ein herrliches Colorit. Weniger schöpferisch als Caravaggio erreichte er diesen Meister jedoch so wenig, wie er die Caracci erreichte. Guercino’s am meisten geschätzte Bilder stammen aus dieser seiner zweiten Epoche, wie Hagar’s Verstoßung, zu Mailand befindlich, und auch unser Bild, Loch mit seinen Töchtern.
Noch immer hatte Guercino aus seiner ersten Periode eine fast ängstliche Sauberkeit und Zierlichkeit der Malerei bewahrt, welche bei ihm die Stelle der Anmuth seiner Schöpfungen vertritt. Bald ward diese Zierlichkeit und das Liebliche, welches da Caravaggio so wenig für sich beanspruchen konnte, um so mehr der Augenpunct Guercino’s, als Guido Reni auf diesem Wege seine ungeheuren Erfolge errang.
Guercino arbeitete sich mit eben der Leichtigkeit in den Styl dieses bewunderten Meisters ein, womit er den Caracci und dem Caravaggio gefolgt war. Alles wird bei ihm jetzt weicher, aber auch ausdrucksloser, die Färbung verliert an Kühnheit, und nur in wenigen Bildern gelingt es ihm, seine immer vortreffliche Zeichnung mit der Kraft und der genialen Charakteristik des Caravaggio und der sanften Anmuth Guido Reni’s zu vermählen. Hier erreicht Guercino im Sanct Bruno zu Bologna zum Beispiel nicht allein den Reni, sondern weiß sich auch eine Eigenthümlichkeit in seinen Schöpfungen zu sichern, die ihm sonst meistens abgeht. Guercino malte eine ungeheure Menge von Altarbildern und viele Fresco-Gemälde u. s. w., an denen zum Theil Schüler aus seiner in Bologna gestifteten Akademie mit arbeiteten. Da der Meister selbst in seinen Kunstschöpfungen schwankte, so konnte diese Akademie für die Kunst keine bedeutende Folge erringen.
Der Gegenstand des hier gewählten Bildes, welches die Größe kräftig andeutet, die der Maler auf seinem zweiten Wege errungen haben würde, ist bekannt. Sodom und Gomorrha werden vom Feuer des Himmels verzehrt, es „geht Dampf auf von der ganzen Gegend, wie von einem feurigen Ofen“, und Loth, der von Engeln Errettete, hält mit seinen Töchtern auf dem Berge Rast, auf welchem seine spätere Zuflucht, das Städchen Zoar, in der Vulgata Segor, das heißt, klein, wenig, genannt, liegt. Die statuenartige Gestalt in der Ferne ist Loths Weib, welche „sich, dem Verbote zuwider, nach Sodom umsah, und in eine Salzsäule verwandelt wurde“.
----
===Der Abend. Von Johann Both.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 053.jpg|600px|center]]
Auf der Piazza del Popolo in Rom hielten an einem schönen Septembertage des Jahres 1649 „hoch zu Rosse“ drei Reiter in einem Kreise von etwa einem Dutzend feingekleideter Herren, die sich durch Tracht und Manieren schon dem Entfernteren als Fremde, und zwar als Maler ankündigten. Auch die Reiter waren ersichtlich Maler und sie schienen im Begriffe zu stehen, eine der sogenannten Scenenjägereien anzutreten. Man händigte ihnen von mehrern Seiten Zettel mit Adressen von Bekannten, von Gastwirthen und Klöstern ein, man machte sie auf malerische Gegenden mit großer Lebhaftigkeit aufmerksam, so daß der eine Maler kaum seine Finger rasch genug bewegen konnte, um alle diese Notizen aufzufassen und in seine dicke Schreibtafel einzutragen. Die andern Beiden beschäftigten sich, während dieser Aemsige fast vor Geschäften schwitzte, auf bequemere Weise. Der zweite Maler, welcher mit dem Notizenschreiber eine wahrhaft frappante Aehnlichkeit hatte, trank unaufhörlich den um ihn stehenden Freunden aus einer mächtigen Feldflasche den Abschiedsgruß zu. Bereits dreimal war einer der Künstler mit dem ausgeleerten Gefäß in größter Eile nach einem Weinhause des Corso gelaufen, um neuen „Stoff“ zur Verlängerung der Abschiedsfeierlichkeiten herbeizuschaffen und allem Anscheine nach hatten diese bedeutungsvollen Wanderungen nur erst begonnen. Der dritte Künstler war ein fetter kleiner Mann, der vor sich auf dem Pferde einen bunten, langohrigen Hund hielt, den er unermüdet liebkoste, während er ihm von Zeit zu Zeit eine gute Portion von dampfenden, von Sauce tropfenden, würmergleichen Fadennudeln in die Schnauze steckte, ein Gericht, das der Maler mit wahrhaft italienischer Gefräßigkeit, auf ächt italienische Art, mit den Händen der Schüssel eines neben ihm stehenden Maccaroniverkäufers entnahm.
Das Notizenschreiben des Einen, das obstinat fortgesetzte Trinken des Zweiten und das unerschütterlich consequent durchgeführte Nudelnessen des Dritten, wurde durch einige neue Personen unterbrochen. Diese waren ein ungeheuer fetter Mönch und ein ziemlich zerlumpt sehender römischer Bürgersmann von bescheidenstem Körperumfange. Der Römer hatte, seit diese zukünftigen Reisenden sich noch auf der Piazza del Popolo verweilten, hinsichtlich der Pferde, welche er und Niemand anders hergeliehen hatte, einige wichtige neue Beschlüsse gefaßt. Zur Execution des ersten derselben hatte er den Mönch mitgebracht. Die abgetriebenen Klepper sollten eingesegnet werden. Trotz aller Protestationen der darauf sitzenden Herren begann der Mönch seine Hände auf die schmutzigen Köpfe, auf die langen Ohren und magern Hälse der Pferde zu legen und mit einer Stentorstimme den heiligen Antonius in dem sogenannten „Pferdegebete“ anzurufen, über die altersmüden Glieder dieser Rozinanten voller Gnade zu wachen.
Hiernach that der Pferdeverleiher seinen unwiderruflichen Entschluß kund, seine Pferde im Auge behalten zu wollen, da er, wie er sagte, fürchte, ihnen möchte bei den zu erwartenden schweren Strapazen die gewohnte liebevolle Pflege abgehen. Alle Maler disputirten mit dem Italiener, um ihn zum Zuhausebleiben zu bewegen; sie gingen sogar so weit, den Pferdeverleiher mit Schlägen zu bedrohen, weil er es wage, Künstler in dem Verdachte zu haben, sie könnten sich in Pferdediebe verwandeln – vergebens. Wer vermöchte es, einen Römer und zwar einen für seinen Geldbeutel raisonnirenden Römer niederzuraisonniren? Pompeo fluchte und schwor und weinte und declamirte so lange, bis ihm die Maler nicht allein erlaubten, zu Fuß neben den Thieren herzutraben, sondern ihm noch obendrein ein genügendes Trinkgeld für seine Bemühungen zusicherten.
Nachdem diese Scenen sämmtlich vollständig erledigt waren, nahm Pompeo nach erhaltener Erlaubniß seinen langen Stecken, schrie seine edlen Thiere mit gellender Stimme an, applicirte jedem derselben einen sehr wenig liebevollen Hieb über die Kruppe und lief, während die zurückbleibenden Künstler Lebewohl riefen und die Hüte schwenkten, wie ein Windspiel den in hartem Trabe Abreitenden voran, in Einem fort: Platz! Platz! schreiend.
Die Reise war angetreten und ein Kleeblatt war unterwegs, wie es unzertrennlicher selten in Rom in der Künstlerwelt bewundert wurde. Der Notizenschreiber mit dem Schnurr- und Zwickelbarte, eine sehr offene, heitere Miene zeigend und mit ersichtlichem Vergnügen von Zeit zu Zeit an den Steigbügeln hinabsehend, war Johann Both, ein Utrechter von Geburt, neununddreißig Jahre alt, ein Landschafter. Johann Both, mit genialer Leichtigkeit malend, der frischesten Tinten, der entzückendsten Beleuchtung mächtig, hatte seinen Gemälden neben den gefeiertsten Stücken Claude Lorrains Geltung und Bewunderung verschaffen können. Die Landschaftsmaler unter Johann Boths Freunden waren mehr als einmal bei dem Versuche verzweifelt, in ihren Bildern den warmen, gesättigten, duftigen Ton zu treffen, welcher gleich einem milden Zauber über den sich sanft abwärts neigenden Thälern und den scharfen Bergumrissen, über den reizenden lichten Waldesplätzen und den seeähnlichen, weiten Teichen lag, die Johann malte.
Der einzige Trost für seine eifersüchtigen Freunde war bei dieser überlegenen Meisterschaft des Holländers der Umstand, daß Johann eben nichts weiter mit Auszeichnung malte, als Landschaften. Sie konnten daher seiner in einer einzigen Richtung vollendeten Kunst ihre mittelmäßige Vielseitigkeit entgegenhalten, um sich neben ihm zu behaupten. Die Feinde dieses Malers behaupteten steif und fest, Both sei eigentlich gar kein Maler, geschweige denn ein Meister, und sei ja etwas Gutes an seinen Bildern, so könne es nur die Staffage sein, die Johann Both nicht gemalt habe.
Die Staffage malte nämlich in der Regel der Bruder und unzertrennliche Gefährte Johanns, Andreas, der um ein Jahr jünger als der Landschafter war. Es war eben derselbe, welcher den Mantelsack, den einzigen der Gesellschaft, auf sein Pferd geschnallt und sich zum Kellermeister während der Reise aufgeworfen hatte. Bamboccio faßte schwerlich leichter das Charakteristische alltäglicher Menschengestalten und Scenen auf, als Andreas Both; dieser jedoch malte nicht mit solcher Derbheit; es lag etwas wie Wouverman’sche Feinheit und Eleganz in Andreas Boths Compositionen, das herrlich zu den Landschaften Johanns paßte. Es war ein merkwürdiger Wechselverkehr in dem Genie der Brüder Both. Ohne Andreas’ Figuren würden Johanns Landschaften bei allen ihren Schönheiten todt, oder schärfer, matt und ausdrucklos gewesen sein; wie im Gegentheil die geistvollste Staffage des Andreas ohne Johanns Landschaft kaum mehr als den Charakter einer Studie gezeigt hätte, – eine Wahrheit, welche die von jedem Bruder allein in seinem Genre gelieferten Blätter bezeugen. Die Boths ergänzten sich so harmonisch, wie es wohl selten bei einem Künstlerpaar vorgekommen, und diese Harmonie, von zwei hochbegabten Künstlerseelen getragen, war der Art, daß selbst ein Claude Lorrain nicht diese herrliche Zusammenstimmung, diesen Einklang der Landschaft und der Staffage erreicht hat, wie ihn die Boths in Gemeinschaft hervorbrachten. Johann Both opferte die Schönheiten der Landschaft zu Gunsten einer überwiegend reizenden Staffage und Andreas modulirte seine gelungensten Erfindungen, um nicht über den Gehalt der landschaftlichen Schöpfungen seines Bruders hinauszuschreiten.
Der dritte im Bunde war Charles Du Jardin, ein Franzose. Er war die verkörperte Komik; eben so launig in seinen herrlichen Figuren als in seinem eigenen Wesen. War der meistens in Gesellschaft trinklustiger Freunde verharrende Andreas nicht aufgelegt und nicht witzig genug, um für Johann eine Landschaft zu studiren und die Staffage dazu zu erfinden: so stellte sich Charles Jardin ein, er, der ewig Nüchterne, dessen Leidenschaft sich nur auf Bonbonkauen und Maccaroniessen beschränkte. Auch er verstand den Johann so genau, daß er die köstlichste Harmonie zwischen seinen Figuren und den Landschaften des ersteren erreichte und zugleich den Andreas in so weit, daß er Figuren ganz im Sinne des Zechlustigen vollendete, welche dieser halb ausgemalt hatte.
Diese Drei waren am zweiten Tage ihrer Reise gegen Nachmittags unterwegs und kehrten, auf Betrieb des durstigen Anderies, in einer elenden Gastwirthschaft an der Straße ein. Johann protestirte vergebens, du Jardin fluchte seine besten pariser Patentflüche; aber Andreas war in einigen Punkten, namentlich wenn es Trinken betraf, durchaus unlenksam. Er stieg rasch vom Pferde ab und zeigte den beiden Widerstrebenden durch das zerbrochene Fenster des Wirthshausstübchens fünf total betrunkene Bauern und einen Mönch mit einem großen Bettelsacke, die er sogleich zu zeichnen begann. Dies waren dieselben Personen, welche auf zwei von Andreas’ radirten Blättern verewigt sind – Blätter, die einen um so größeren Werth besitzen, als sie fast verschollen sind. Als der dicke, die Bauern haranguirende Mönch mit dem Sacke, halb fertig war, stieg Charles du Jardin eiligst vom Pferde, machte sein kleines Zeichnenbrett fertig und wollte in das Innere des Wirthshauses dringen, um die Betrunkenen zu zeichnen.
Pompeo sprang herzu.
– Ich bitte Euch, Herr Franzose, rief er, bleibt nur das Mal aus dieser Banditenstube; namentlich unterfangt Euch nicht, den Leuten Eure Zeichnenapparate sehen zu lassen; denn sie sind der Meinung, daß jeder abgemalte Mensch binnen einem Jahre sterben müsse.
– Die abgemalten Menschen sterben nie; wenigstens unsere nicht, Andreas! rief der dicke Franzmann und drang, trotz Zwiebel- und Knoblauchduft, kühn in dieses zweite Gasthaus zu Terracina. Um sich der Freundschaft der Landleute zu versichern, ließ er Jedem einen Krug Romagnawein einschenken und fing herzhaft zu zeichnen an. Anderies erschien auch, triumphirend fünf leere Weinkrüge, während seiner Arbeit von ihm geleert, und die Arbeit selbst, den Sack-Mönch, mitbringend. Er setzte den Mönch von der künstlerischen Apotheose desselben ziemlich somnambul in Kenntniß und legte dadurch den Grund zu der nachfolgenden Katastrophe. Der Frate, hochentrüstet, hielt eine wahre Kreuzpredigt gegen die drei fremden Ketzer, die er einer Art von <tt>crimen laesae majestatis</tt> beschuldigte.
Die Bauern erhoben sich. Sie forderten Wein und immer mehr Wein, sperrten hinter dem eben eintretenden Johann Both die Thüre und fingen, als Anderies seine schmale Börse nicht weiter zu Gunsten dieser Durstigen anstrengen zu wollen erklärte, an, die Künstler in eine der regelmäßigsten und hartnäckigsten Prügeleien zu verwickeln, die je von Scenenjägern bestanden wurden. Du Jardin wollte seinen Degen gebrauchen; er ward ihm zerbrochen und mit den Enden ward sein fetter, zarter Rücken wie ein Rinderbraten vor dem Schmoren durchgeklopft. Anderies wehrte sich, auf der Erde liegend, mit Händen und Füßen so nachdrücklich, daß ihm die geringste Portion zugemessen wurde; Johann, der weichmüthige, ließ sich dagegen widerstandlos durchprügeln.
Als die Bauern und der Mönch, denn auch dieser hatte tapfer mitgefochten, endlich ermüdet waren, gaben sie die Reisenden frei. Halb sinnlos taumelten diese zur Hütte hinaus, wo sie der feige Pompeo heulend empfing.
– Warum, Du Canaille, hast Du uns im Stich gelassen? schrie der mit purpurglühenden Wangen prangende Du Jardin.
– Ich habe für Sie gebetet! schrie Pompeo retirirend. Denn bei diesen Hieben konnte ich nicht erwarten, daß Sie lebendig blieben.
Die Maler setzten sich zu Pferd in der düstersten Stimmung, die sie seit Jahren erprobten. Anderies wüthete gegen den feigen Johann, gegen Du Jardin, Du Jardin gegen Anderies, und fing zuletzt darüber zu weinen an, daß sein geliebter Hund auch furchtbare Hiebe, unschuldige Hiebe, empfangen hatte. Kurz, dicht vor dem Dorfe an einem kleinen Bache, der einen malerischen, von Bäumen überhangenen Teich bildete, hielten die erzürnten Freunde an. Johann, sehr zerhauen und schwermüthig, tränkte sein mattes Roß; Anderies ließ sich von Pompeo seinen rechten, zerschlagenen Fuß verbinden; Du Jardin ritt wieder nach Rom zurück und war außer sich, daß er durch alles Locken seinen Hund nicht bewegen konnte, die Brüder zu verlassen.
Johann ermannte sich wieder.
– Brüder! schrie er mit klarer Stimme, was sind wir ausgeritten, zu sehen, wie die Mönche predigen? Was wollten wir finden? Landschaften und Scenerien, Staffagen. Die Landschaft? Da liegt sie. Die Staffage? Male jeder von Euch sich selbst und theilt Euch in mein und Pompeo’s Ebenbild, und wir, mit unsern geprügelten Körpern, passen in diese Abendlandschaft, als wenn Charles oder Anderies in ihren schönsten Augenblicken unsere Cavalcade erfunden hätten.
– Was? schrie Du Jardin, die Hand ans Ohr haltend; denn es hatte ihn längst gereut, fortgeritten zu sein.
– Komm nur, Bacchus! rief Anderies, seine Trinkflasche, welche er glücklich gerettet hatte, emporhaltend.
– <tt>Oui, Sancho Pança! </tt> und der Franzose trabte mühsam und ächzend heran.
Alle Drei lagerten sich an dem herrlichen, kühlen Platze und unter Seufzen und Stöhnen über die schmerzenden Gliedmaßen kam hier ein Bild im Entwurfe zu Stande, das hinfort nur das „Dreimännerbild“ genannt wurde, weil das Kleeblatt dasselbe gemeinschaftlich ausführte.
Als die Skizze vollendet war, sah der sanfte Johann die Busenfreunde an.
– Soll die Reise wirklich bis Ancona gehen? fragte er ernsthaft.
Ein lautes Gelächter war die Antwort.
– Rom! Rom! riefen die Andern.
– <tt>Ah, Carissima; ah, Roma! </tt> jubelte Pompeo tanzend. Welches Glück, daß die <tt>Signori Tedeschi</tt> Prügel empfingen. Vorwärts, Peppo, Selmo und Sandro; auf der Piazza del Popolo ist Euer Ruheziel! Vorwärts, Vorwärts!
Und abermals lief er wie ein Windspiel nicht vor, sondern hinter seinen Gäulen her, ihre Hintertheile noch unbarmherziger dreschend, als die betrunkenen Bauern die Künstler bearbeitet hatten.
Diese, in Rom angekommen, vollendeten ihr Dreimännerbild und gaben von dem Honorare dafür ein Banket, wie es sich noch lange als unübertroffen in den Sagen der zechlustigen Jünger der Kunst in Rom erhalten hat.
----
===Danaë und der goldene Regen. Von Anton van Dyck.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 054.jpg|600px|center]]
An einem höchst unfreundlichen Novemberabende im Jahre 1639 rollte eines der schweren, goldverzierten, mit vier Pferden bespannten Fuhrwerke, wie sie der Hof und der hohe Adel besaß, die schlechten Straßen vom Witehall-Palaste entlang dem Herzen von London zu. Jetzt stirbt in diesem Stadtquartiere das Leben des Londoner, um fünf Uhr Nachmittags beginnenden Tages, schwerlich vor zwei Uhr Nachts. Damals aber, als selbst die ersten Classen der Gesellschaft höchstens drei Stunden mit dem Beginn ihres Tages hinter der Sonne zurückzubleiben pflegten, war es um 12 Uhr – und diese Stunde hatte eben die Glocke St. Paul’s, von einigen Hundert andern Glockenschlägen accompagnirt, geschlagen – in London still, öde und wirklich Nacht. Nur mit Mißvergnügen hörte der Bürger, wohl zugedeckt im Bette befindlich, wenn der rasche, klappernde Hufschlag von Rossen, die den „Königstrab“ gingen, zu Mitternacht durch die Straßen hallte; wenn die Fenster seines Hauses bebten und klirrten von dem Rasseln einer der Kutschen, welche nach dem Modell der Arche Noah’s gebaut zu sein schienen.
Das waren Lords und Ladies vom Hofe des zwar ritterlichen, aber vergnügungssüchtigen und verschwenderischen Karls I., welche sich bestrebt hatten, das Mark von Alt-England zu verprassen. Der Herrenkutsche folgten auf ihrem einsamen Wege sicherlich mehr Flüche und stille Verwünschungen, als sie Straßen durchrollte. Ihre Insassen waren bereits vom Volke heimlich gerichtet, bevor sie noch eine Ahnung davon besaßen, auf welchem Vulkane sie ihre bezaubernden nächtlichen Feste feierten.
Sicherlich aber verdiente derjenige, welcher heute Nacht, einem Herzoge oder einem Fürsten gleich, über St. Martins Lane und Long Acre nach Lincolns Inn Fields fuhr, keinen der Vorwürfe, welchen die Engländer ihrem Könige und seiner Ritterschaft mit schwerem Gewicht auf die Schultern legten. Dieser Mann war ein Arbeiter, wie der fleißige Bürger; er glänzte nicht durch den erpreßten Schweiß seiner Untergebenen, sondern sein fürstlicher Aufwand war von dem von ihm ehrlich „verdienten“ Gelde bezahlt. Er führte weder Herzogs- noch Adelswappen, auf welches er seine Hoffähigkeit hätte gründen können. Sein Genie und seine Kunst allein hatten ihn zum Freunde „der Könige“ gemacht und ihm die für jeden Mann niederer Herkunft mit ehernen Banden verschlossenen Säle des Herrschers von England und der Großen des Reichs geöffnet.
Anton van Dyck, der niederländische Maler war es, welcher zu so später Stunde durch London fuhr. Er kam vom König in Witehall und wollte, bevor er in seinem palastähnlichen Gebäude in Black Fryars sich zur Ruhe begab, zuvor noch eine jener Gesellschaften des deutschen Grafen von Aremberg besuchen, in welchen sich die ausgezeichnetsten Männer und Frauen der Hauptstadt Rendezvous’ zu geben pflegten.
Lincolns Inn Fields war damals und auch später für viele große Herren, namentlich Staatsmänner, ein beliebter Wohnort. In der Umgebung Lincolns Inn, Chancery Lane, Holborn, war eine Art von Hauptquartier der Leute von Rang, Reichthum und Geist, eine Gesellschaft, der sogar die Repräsentanten des geistlichen Standes nicht fehlten; denn damals wohnte der Bischof von Chichester in seinem Palaste bei Lincolns Inn, dicht neben der Kaserne seiner Leibwache, dem Kloster der Blackfriars.
Der Graf Aremberg wohnte Ecke von Holborn und Chancery Lane und hier war’s, wo Anton van Dyck vorfuhr.
In diesem Palaste wars ungeachtet der Mitternacht heller Tag. Die Flügelthüren waren weit geöffnet, so daß der Lichterglanz weit über den freien Platz strahlte. Riesen gleich standen zwei westphälische Portiers, mit Goldtressen überladen, jeder eine moderne Art von silberner Herkuleskeule in der Hand, zu beiden Seiten des Portals und auf dem Flur, auf den mit Stein-Mosaik gezierten Treppen im Innern flogen englische und französische Diener und Dienerinnen.
Der Maler stieg aus und ließ sich die Palasttreppe von seinem Diener hinangeleiten. Auf dem Flur legte er seinen herrlichen flandrischen Spitzenkragen glatt, gab seinem schwarzsammetnen spanischen Mantel einen Faltenwurf, wie es nur ein Römer oder ein Maler versteht, und nahm den ungeheuren Federhut ab. Einen edleren, schöner geformten Kopf, als ihn der Maler zeigte, hatte sicherlich die hohe Gesellschaft oben nicht aufzuweisen. Reizender als van Dycks Haar in Wirklichkeit war, konnte nur er selbst es malen. Eine gewisse Abgespanntheit, welche auf des Malers Zügen lag, contrastirte eigenthümlich mit dem Feuer seiner großen Augen und mit dem kriegerischen Ausdruck, den sein brauner Schnurrbart und die große, spanische Imperiala am Kinn der Erscheinung verlieh.
Die Etikette, das ungeheuerlich Steife, womit damals der Mode nach Leute von Range sich umgaben, fand in diesem Palaste nur bis vor den Thüren des Allerheiligsten, des Gesellschaftszimmers Platz. Van Dyck überwand die Empfangscomplimente des Major Domus, die Anmeldungs- und Einladungsscene, welche er mit dem französischen Kammerdiener aufführen mußte, und ließ sich geduldig von den genannten beiden dienstfertigen Geistern an den linken und rechten Ellenbogen fassen und die Treppe, so zu sagen, hinanschieben. Die Thüren öffneten sich und van Dyck athmete auf und lächelte, als er den kleinen aber erlesenen Kreis überblickte. Hier hörte jeder Zwang auf! Etwa sechzehn Herren und Damen begrüßten den Maler mit jenem vertraulichen, graziösen Lächeln, das, in Frankreich erfunden, die Reise um die Welt gemacht hat, seitdem Ernste der ersten französischen Revolution aber von der Erde verschwunden, oder zur Grimasse geworden sein soll. Ueberall begegnete der schöne Mann, der jetzt in der kleidsamen Hoftracht, mit dem langen, schmalen Degen an der Seite, ohne Mantel eintrat, heitern und bewundernden, oder gar entzückten Blicken. Van Dyck grüßte die Gesellschaft mit derselben ceremonielosen verbindlichen Grazie, womit sie ihn empfangen hatte, und folgte dem kaum bemerkbaren Winke von einer der schönsten Hände im Saale. Lady Venetia Dygby, ein wahrer Stern von Frauenschönheit am Hofe Karls I., dieselbe, deren Reize van Dyck durch eins seiner schönsten Portraits (in Windsor befindlich) verewigte, beschied den Maler als ihren Cavalier hinter ihren Sessel.
Die Gesellschaft spielte. Die Damen saßen um einen schmalen, langen Tisch. Die meisten Herren, außer dem die Bank haltenden Viscount Edgefield, einem geistreichen Podagristen, dem schönen Grafen von Aremberg und den beiden renommirten Witzbolden – den einzigen gegenwärtigen Geldarmen – Mr. Frederic Carew und Mr. Killigrew, hatten sich nicht gesetzt, sondern standen hinter oder neben den Stühlen der Ladies und pointirten von hier aus. Auch van Dyck, dessen Leidenschaftlichkeit blos aufgefordert zu werden brauchte, nahm die Karte.
Hier unter dem graziösesten, geistreichsten und halb frivolen Gedankenspiele, immer durch neue Einfälle und Bemerkungen wach erhalten, deren Charakteristik wir aus den modischen Schriften jener Tage nur unvollkommen kennen lernen können, machte sich das eigentliche Spiel in einer solchen Weise, daß ein jeder nicht mit fürstlichem Vermögen Gesegnete von diesem Tische ehrfurchts-, oder grauenvoll zurückgetreten wäre. Der Dichter Killigrew und sein Nachbar Carew spielten daher nur mit Worten, während Lord Edgefield auf einen Schlag Hunderte von Guinees gewann und verlor und dabei keine Silbe, als: ah! sagte. Dieser zeitweilige Ausruf bezog sich jedoch auf sein schmerzendes Bein und nicht auf sein Spiel.
Ungeachtet aller scheinbaren Abwesenheit von Leidenschaftlichkeit entwickelte sie sich dennoch und zwar bei dem Grafen Arundel und bei van Dyck. Durch ihre hohen Sätze brachten sie Leben in das Spiel; Gewinn und Verlust wurden bemerkbarer. Arundel verlor fünfhundert Guinees, die er nicht ausbezahlte; van Dyck gewann hundert und funfzig, welche ihm der alte Bankherr, der nie aufs Wort spielte, bis auf die letzte Guinee sofort zuschob.
Van Dyck bog sich über die Stuhllehne und die weiße Schulter von Lady Venetia, um seiner Beute sich zu bemächtigen.
– Halten Sie beide Hände hierher! rief Lady Digby, indeß sie mit blitzenden Augen sich nach dem Maler umschaute.
Van Dyck gehorchte. Er streckte seine Hände, fein und zart gleich denen einer Dame, über ihren rechten Arm und Lady Venetia füllte sie mit Goldstücken. In dem Augenblicke aber, als er dieselben über ihre Schulter zurückziehen wollte, erhob sich die Dame mit der ihr eigenen Lebhaftigkeit zur Hälfte, um einige noch auf dem Tische liegende Goldstücke dem Maler ebenfalls zu übergeben.
Lady Venetia stieß an Van Dycks Hände und gleich einem goldenen Regen sielen die Guinees herab. Die wenigsten gelangten zur Erde. Es war ihnen bestimmt, kurze Zeit an einem der reizendsten Plätze in ganz Alt-England aufbewahrt zu werden. Schon damals trugen die Damen so tief ausgeschnittene Kleider, daß sie, wie ein ebenso zarter als witziger Deutscher sagte, wie Kleinodien aussahen, die etwas zu weit aus dem Futteral gezogen wurden. Jetzt liegen die Damenkleider fest an Schulter und Nacken; damals waren sie aber weit; der Busen war mit einem steifen, fächerartig sich ausbreitenden Mieder versehen, welches zwar bis zur Höhe des Halses emporstieg, dennoch aber, eben weil es oben weit vorwärts stand, ebensowenig wie ein pariser Ballkleid aus dem Jahre der zweiten französischen Republik irgend eine Schönheit versteckte.
Hinter dieses fächerartige Mieder, welches die Formen der Lady Venetia umschloß, nicht weniger zwischen ihren Nacken und die weiten Rückenfalten ihrer Seidenrobe, fielen van Dyck’s Goldstücke.
– Eine Danaë! bemerte Mr. Carew, als die reizende Dame, ziemlich bestürzt über die Kälte des goldenen Regens, sich erhob.
Der vom Glücke begünstigte van Dyck nahm die Entschuldigungen der Lady Digby mit Heiterkeit an, welche sich zur Zahlung der so unwillkürlich vorgestreckten Summe während der bekannten vierundzwanzigstündigen Frist erbot. Sicher gemacht durch seine Erfolge, spielte van Dyck weiter, und war bald so „glücklich“, auch das letzte Goldstück zu verlieren, welches er besaß. Die Nacht war weit vorgerückt und Graf Arundel, Mr. Killigrew und der niederländische Maler zogen sich zurück, dem Viscount Edgefield und seinen Gegnern das Schlachtfeld des grünen Tisches überlassend.
Als van Dyck nach Black Fryars fuhr, hörte er seinen Namen mit Heftigkeit ausrufen und ungeachtet des scharfen Trabes der Pferde ward der Kutschenschlag aufgerissen und ein schlanker junger Mann voltigirte in das Fuhrwerk herein. Derjenige, welcher auf so unceremoniöse Weise zu van Dyck eindrang, fiel ihm um den Hals und blieb längere Zeit sprachlos.
– Fiamingo! rief van Dyck in italienischer Sprache. Du bist’s?
Carl Fiamingo, einer von van Dycks genuesischen Freunden war’s, der einzige Italiener, welcher sich während van Dycks Anwesenheit in den Niederlanden innig und ehrlich an ihn angeschlossen hatte.
Carl Fiamingo war Maler. Er besaß vielleicht nicht weniger Talent als van Dyck; verstand aber unglücklicherweise die Kunst nicht, seine Leidenschaften in so weit zu mäßigen, um mit Besonnenheit arbeiten zu können. Selten hatte Carl Fiamingo Augenblicke, die er „seine Glanzlichter“ nannte, Augenblicke, in denen er die herrlichsten, kühnsten Schlachtenbilder zu entwerfen vermochte. Fiamingo malte ganz in der breiten Manier der Niederländer; das Talent, welches er besaß, in unglaublich kurzer Zeit mit wenigen Strichen und schroffen Farben ein Gemälde zu vollenden, war wahrhaft einzig. Van Dyck hatte den kaum dreiundzwanzig Jahre alten Künstler aus dem Strudel der Ausschweifungen, worin er versunken war, zu erretten versucht; auf seine Veranlassung hatte Fiamingo Genua verlassen und war nach London gekommen. London aber hatte den heißblütigen Italiener erdrückt; hier eben hatte er sich selbst völlig verloren.
Van Dyck umfing den Italiener. Es war draußen kalt; es regnete weder, noch schneite es. Um desto mehr erschrak van Dyck, als er Brust und Leib des Freundes „bethaut“ fühlte.
– Was ist denn das? fragte er, die Hände abwischend.
– Blut, Signor, Blut! rief Fiamingo. Wäre doch der Stoß besser gewesen; oder hätte ich denjenigen empfangen, den Lord Wenkworth erhalten hat.
Eine kurze Erzählung folgte. Fiamingo hatte mit seinem Busenfreunde, Lord Wenkworth, Streit gehabt. Im Zustande halber Trunkenheit waren Beide dazu gerathen, diese Differenz sogleich auf der Straße mit dem Degen auszugleichen. Wenkworth war von dem verwundeten Fiamingo erstochen. Wollte der Italiener nicht gehenkt werden; so galt es schleunigste Flucht aus England.
Van Dyck hatte seine Fassung wieder erlangt und war entschlossen, den italienischen Maler zu retten. Geld war das Erste, welches nothwendig war. Van Dyck, der unglücklich genug war, eben jetzt nichts zu besitzen, ließ seinen Kutscher augenblicklich wieder nach Holborn fahren . . . Der Palast des Grafen Aremberg war geschlossen.
– Nach Ludgate Hill, Lord Henry Digby! rief van Dyck.
Hier waren wenigstens noch offene Thüren. Van Dyck stieg aus und fragte nach Lady Venetia. Sie kam ihm selbst auf dem Corridor des ersten Stockes entgegen, noch vollkommen angezogen. Augenscheinlich war sie keine fünf Minuten zu Hause gewesen.
– Milady! stammelte van Dyck. Ich rufe Ihren Beistand für einen unglücklichen Freund an, der in dieser Minute von London fliehen muß. Mein schlimmes Glück heute Abend kennen Sie, ich bitte Sie um ein Darlehn von hundert oder zweihundert Guinees.
Und darauf gestand er der Dame, warum es sich heute Nacht handele.
Die Dame kam augenblicklich aus ihrer vornehmen Nachlässigkeit zu einer feurigen Energie.
– Auch ich, mein Herr, bin von diesem Geldwolfe, von Lord Edgefield total ausgeplündert! sagte sie. Es wird aber dennoch leicht Rath werden. Tom! rief sie dem Diener zu, ist Mylord zu Hause?
– Nein; ist gestern Morgen zur Fuchsjagd abgereiset! antwortete dieser.
– Wo ist der Haushofmeister?
Der Geforderte, gerade ein Haushofmeister wie ihn Hogarth in seiner Manage <tt>à la</tt> Mode zeichnete, ein geiziger, felsenehrlicher Murrkopf, erschien.
– Zweihundert Guinees! sagte Lady Venetia kurz.
– Von mir? erwiederte Mr. Leakes sehr ruhig.
Die Dame maß den Alten mit einem flammenden Blicke. Er machte unwillkürlich eine Verbeugung, sagte aber dann flüsternd:
– Milady, ich bin unendlich betrübt, aber ich habe gemessenen Befehl. Ich glaube, Sie werden mir meine Pflicht nicht schwerer machen . . . Aber, Seine Herrlichkeit, Mylord Henry Dygby, haben mir verboten, Ihnen, gnädige Frau, außer den hundert Pfunden, die Sie gestern Morgen erhielten, bis zu Mylords Rückkehr auch nur einen Halfpenny auszuzahlen. Haben Sie weitere Befehle, so stehe ich zu Diensten.
Lady Venetia wandte sich erbost und indignirt ab. Sie war völlig erstarrt. Plötzlich schien ihr ein Gedanke zu kommen.
– Folgen Sie mir, Meister! sagte sie lebhaft. Sie werden Geld haben; denn ich erinnere mich, daß Sie mich vorhin zur Danaë machten.
Van Dyck blieb im Vorzimmer. Die Dame eilte in ihr Cabinet und ließ sich rasch auskleiden. Die Schnürbrust nur hielt noch die Goldstücke.
– Einen Augenblick, Elise! rief Lady Venetia. Wir haben keine Secunde zu verlieren. Bliebe ich stehen, so würden die Guinees im ganzen Zimmer umher rollen und wir müßten suchen.
– Guinees? fragte die Alte erstaunt.
– Ja doch!
Damit warf sich die Dame auf ihr prachtvolles Sofa und ließ sich in dieser Lage entkleiden. Die alte Elise raffte das Geld zusammen, um solches, dem Befehle Venetia’s gemäß, dem Maler zu überbringen. Wußte die Dienerin nicht, daß van Dyck in dem Vorzimmer harrte, oder war die Dienerin über der eigenthümlichen Scene verwirrt geworden – genug, sie öffnete eine Seitenthür des Cabinets, welche gleich der Flügelthür ebenfalls ins Vorzimmer ging, und gab auf diese Weise dem harrenden Maler einen vollen Anblick der Schönheit ihrer Gebieterin.
Van Dyck faßte sich bald, nahm das Geld und schied. Fiamingo ward gerettet. Er kam glücklich nach Milano, welche Stadt einige seiner schönsten Schlachtenbilder aufzuweisen hat.
Van Dyck aber konnte von diesem Abende an die Erinnerung an die Danaë nicht aus den Gedanken schlagen, um so mehr, als Lady Venetia es beharrlich verweigerte, ihn zu sehen.
Der Meister gehorchte seinem innern Drange und malte seine herrliche Danaë mit der Alten, wie der Herr des Olymps ihr in dem blitzenden Goldregen naht. Die Danaë und die Dienerin waren herrliche Portraits von Lady Venetia und Mrs. Elise. Kaum vollendet sandte van Dyck das Bild zu der Dame, die er längst heimlich anbetete, mit diesen Zeilen:
– Hat die Kunst Ihre Schönheit zu verewigen vermocht: so wird die Danaë aufhören zu erröthen.
Am andern Tage fuhr die Dame selbst vor dem Palaste des Malers in Black Fryars vor und seit diesem Augenblicke ward die „Danaë des van Dyck“ in dem Prachtsaale Mylord Digby’s für die Bewunderung der hohen Welt frei ausgestellt.
----
===Die Brüder. Von C. L. Vogel.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 055.jpg|600px|center]]
Der Schöpfer dieses ausgezeichneten Bildes ist ''Christian Leberecht Vogel, '' ein in der Künstlerwelt oft genannter und geschätzter deutscher Historienmaler. Er ward 1759 zu ''Dresden'' geboren. Sein Vater, welcher bei Hofe angestellt, bestimmte ihn für seine Beschäftigung, obgleich sich bei dem Knaben das entschiedenste Talent für seine Kunst zu regen begann. Noch sehr jung, machte Vogel Aufsehen durch seine Zeichnungen und Malereien, namentlich durch seine Portraits, wie er denn als kaum 12jähriger Knabe sein eigenes Portrait in Pastell vollendete.
Der Hofmaler Schönau ward auf den vielversprechenden Knaben aufmerksam und nahm denselben als seinen Schüler an. Rasch bemächtigte er sich der Elemente seiner Kunst, und begann auf der Kunstakademie zu Dresden mit so glänzendem Erfolge seine Studien, daß ihn die Akademie als ihren Pensionair annahm. Im Jahre 1780 verließ der Künstler Dresden und begab sich nach Wildenfels im Erzgebirge, um die Familie des Grafen Solms zu malen. Erst im Jahre 1804 kehrte er von hier als Mitglied der Kunstakademie nach Dresden zurück, ward in Folge seiner theoretischen Kunstkenntnisse 1814 an derselben Professor und starb den 6. April 1816.
Vogel blieb der ursprünglich von ihm aus einer Art unbewußten Triebes eingeschlagenen ''Richtung, derjenigen des Portraits,'' getreu und versuchte von hier aus seinen Aufschwung in die höheren Regionen der Kunst zu nehmen. Fast alle seine größeren historischen und Genre-Stücke weisen auf diese Portrait-Richtung zurück. Im Portrait war Vogel ausgezeichnet; es war seine Lieblingsbeschäftigung, dergleichen zu malen. Er lieferte daher eine große Anzahl derselben, die sich sämmtlich durch eine ''klare, mehr anmuthige, als scharfe und schlagende Charakteristik'' bemerklich machen.
Unter seinen größeren historischen Stücken verdient das Altarblatt in der Kirche zu Lichtenstein hervorgehoben zu werden.
Eine höchst geistreiche Auffassung, eine leichte und gefällige Anordnung seiner Gegenstände, zeichnet unsern Künstler aus. An ''Zartheit seines Pinsels '' ist er unvergleichlich und seine Zeichnung athmet die hinreißende ''Weichheit '' Raphaelischer Formen. Vogel vermag es aber nicht, sich seiner Individualität zu entäußern, besser, darüber hinauszuschreiten, um sich durch den ''Glanz '' und die ''Macht des Colorits '' über das Anmuthige und Sanfte zu ''erheben. ''
Die ''Perspective '' vernachlässigt Vogel sehr, er ignorirt sie nicht selten. Er scheint es wie absichtlich zu verschmähen, durch umfassende ''Composition, '' oder durch Beiwerk das Interesse des Beschauers zu zersplittern und die Aufmerksamkeit desselben von einigen wenigen Menschengestalten abzulenken, welche ''er mit dem ganzen Reichthum seiner schöpferischen Phantasie ausgestattet hat. ''
Vogel ist, ungeachtet seiner fleißigen Studien, namentlich der italienischen Meister, ''durchaus deutsch '' geblieben.
Das vorliegende Bild, in welchem sich der Künstler vielleicht auf seine höchste Höhe gestellt hat, charakterisirt ihn vollkommen.
Ein ''tiefpoetisches, heimliches, lautloses Leben und Weben, eine Innerlichkeit, '' die sich so zwanglos gestaltet, als sei sie nur durch einen aus tiefster Brust ausgehauchten, seelenvollen Seufzer zum sichtbaren Sein geschaffen, bewundern wir namentlich in diesem Bilde Vogels.
Ein unendlicher Reiz ist über die beiden Kinderfiguren ausgegossen. Das ist nicht blos die Idylle, die blauäugige, engelsanfte, fesselnde, deutsche Göttin Vogels! Hier erkennt man durchaus ''dichterisches '' umfassendes Ergreifen des Lebens, seinem vollen Inhalte nach. Man findet hier nicht nur das außerordentlich entwickelte Talent eines Künstlers – und in der That kommt Vogel selten hierüber hinaus – sondern es läßt sich hier eine ''geniale Composition '' nachweisen und eine solche, welche aus dem wahrsten Wesen Vogels und aus ''seiner Grundrichtung, dem Portrait, geradewegs hervorging, '' und daher mehr als ganze Reihen seiner übrigen Bilder für ihn und seinen Gehalt Zeugniß ablegt.
Diese „Brüder“ nämlich '''könnten''' Portrait sein, so unmittelbar schließt sich die hier hervortretende künstlerische Conception Vogels an das nicht blos wahre, sondern wirkliche Leben an. ''Sie könnten es sein, sinds aber nicht.'' Es finden sich hier keine zufälligen – schlechten – Besonderheiten, kein Eigenthümliches – als höchstens der deutsche Nationaltypus – es findet sich kein Apartes, wodurch das Portrait in seiner niedern, dem universellen Zenith als blos individueller Nadir gegenüberstehenden, Richtung befangen bleibt.
In den Brüdern sind die ''Individuen zu Trägern des allgemeinen Begriffs hindurchgedrungen,'' ohne daß jedoch das Individuelle diesem Begriffe ''aufgeopfert wäre.''
Vogel hat in seinen „Brüdern“ keine bloßen Kinder, sondern das ''Kindesalter,'' die ''erste Jugend'' gemalt. Eben durch den großartigen Inhalt dieses in die Welt der Gestaltung getretenen Begriffs, eben durch die Macht dieser hier vollständig zur Erscheinung gekommenen Idee besitzt dieses Bild – in seinem von aller Symbolik entkleideten wahren Leben – eine fesselnde, bezaubernde, unterjochende Gewalt.
Die Brüder sind ''kein'' Idyll mehr, nur das im ewigen Frieden und waffenlos Bezaubernde des Idylls zeigt sich als ein Attribut desselben. Dieses sich ''selbst genügende, wahrhaft paradiesische Sein, der mährchenhafte Beginn des zum Bewußtsein sich hinkämpfenden Menschenlebens,'' steht hier eben in seiner reizenden ''Hülflosigkeit und Waffenlosigkeit,'' eng an das höchste Leben, an die Liebe gebunden, den übrigen Phasen des menschlichen Daseins überwältigend, siegreich gegenüber.
Es ist die ewige nur in der Kindheit sich abspiegelnde Mythe einer goldenen Zeit, die unverlöschbare Geschichte vom Garten Eden, ''die Jeder sich als letztes Ziel setzt, eben weil sein Ursprung darin wurzelt.''
Schaut diese Brüder an, mag es ein Greis, mag es Mann oder Weib, Jüngling oder Jungfrau sein! Sobald der erste, durch das blos Aeußerliche einer vollendeten Formenschönheit bewirkte, Zauber einen Wunsch aufkommen läßt, so zeigt er sich bei Jedem in dem Gedanken: ''Wäret Ihr Kinder doch die meinigen! Euch, Euch möcht ich als mein eigenstes Eigenthum besitzen!''
Ein ergreifend poetischer, wehmüthiger Gedanke! Du willst, nach der Bedeutung des Bildes, welche wir vorhin herauskehrten, nicht etwa ''diese Kinder selbst,'' Du willst die ''Kindheit,'' '''Deine Kindheit, Dein Eden, Dein Paradies''' in ihnen besitzen, welches Dir rückwärts entschwand, während Du dasselbe vorwärts noch nicht zu fassen vermagst! Die vollkommene Glückseligkeit, die göttliche Existenz, die Du nie wieder als nur in Hoffnung in der wirklichen Welt erreichen wirst, die Dir dann noch unerreichbar ist, wenn das Auge zum letzten Schlummer sinkt!
Deutest Du jetzt, sinniger Beschauer, den unendlichen Reiz dieser Kindergruppe?
Der allgemeine Gehalt zwar, wozu sich der liebenswürdige Künstler in diesen „Brüdern“ aufschwang, kann, auf Dich selbst bezogen, ''unendlich variiren. '' Immer aber wird er Dich fesseln! Er kann lieblich, sanft, rührend, elegisch sich in Dein Leben voll edler, freier, menschlicher Anstrengungen und Genüsse schlingen! Eben seines göttlichen Genügens wegen wird dieser Inhalt aber gepanzert in schreiendem Contrast mit der Wirklichkeit sich dem von widerwärtigen, blos materiellen Interessen bewegten Leben mit scharfer Kante gegenüberstellen, und entweder ein bitteres Zürnen mit der wirklichen Umgebung oder melancholische Trauer veranlassen, bis die in dem Gedanken des jenseitigen Gartens der ewigen Jugend liegende Tröstung und Erhebung sich geltend zu machen vermag!
Wir wollen es nicht versuchen, in unsern Reflexionen über dies Kunstwerk wieder einen Rückschritt zu machen, um von diesem Punkte aus das Bild auf ein ''Besonderes zurückzuführen, '' das heißt hier: auf den Grund des Gemäldes hin die ''Bedeutung der Kindheit dem bewußten Leben gegenüber in einer novellistischen Skizze individuell und apart zu fassen. ''
Wir wollen den Eindruck des Bildes dadurch nicht '''beschränken.''' Wir übergeben vielmehr das Blatt – welches auf äußerst gelungene Weise das Colorit des Originals andeutet – nur mit dem Wunsche, daß dasselbe erhebend, besänftigend, veredelnd das Gemüth des Beschauers berühren möge! Und das ist bei Naturen, die für das rein Geistige, wie für das zur Idee hindurchgedrungene Materielle, ''also für die Schönheit, '' Sinn und Empfindung haben, unfehlbar . . .
Deuten wir aber zum Schluß noch auf den Umstand bin, daß das Bild des ältesten Knaben die geistvollen Züge des Sohnes des Meisters, des jetzigen Herrn Vogel von Vogelstein, eines Sternes am deutschen Kunsthimmel, zeigt: so möchte dadurch Manchem ein interessantes Feld von Betrachtungen geöffnet sein.
----⏎
⏎
⏎
⏎
⏎
⏎
{{References|LIN}}
[[Kategorie:Kunstwissenschaft]]
This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|