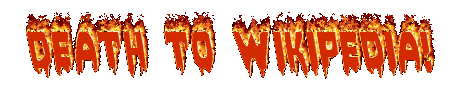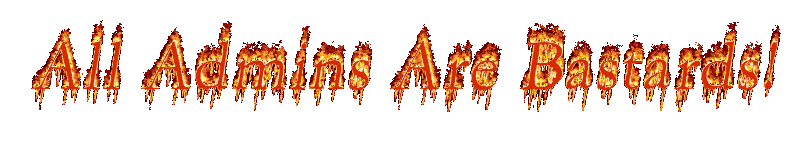If you find this site useful or just support what I'm doing, I'd really appreciate if you could donate. To cover server costs and for the hundreds of hours I've put into making this happen.
- Monero address: 41stbw8H14hFk5QZh4mJiHcX1tHFDwB6r56wVNdkCvkR5Z5JEivJ4ZADDHHSpRNgnJfHn3xJ7RNnjbpgFzgX8udMT9GLBrA