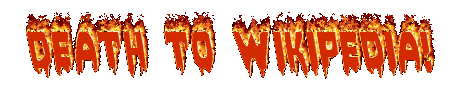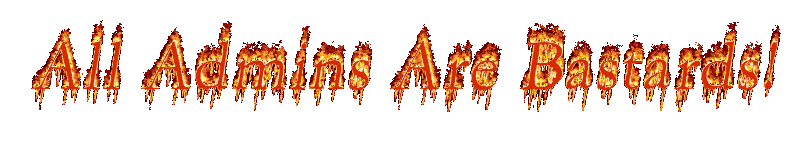Difference between revisions 1993551 and 1993836 on dewikisource{{LineCenterSize|100|23|Der}}
{{LineCenterSize|160|23|'''KUNSTVEREIN.'''}}
{{Linie}}
{{LineCenterSize|100|23|NEUE SERIE:}}
{{LineCenterSize|110|23|''Stahlstich-Sammlung der vorzüglichsten Gemälde''}}
{{LineCenterSize|90|23|der}}
{{LineCenterSize|140|23|DRESDENER GALLERIE.}}
(contracted; show full)ues, Originales; aber nicht sobald vertiefen wir uns in den Anblick des Gemäldes, so empfinden wir auch seine Kraft: das Bild Davids steht jetzt nach des Malers Darstellung in uns fest, es ist ein Typus dieser Gestalt für uns geworden. Das Costüme, obwohl nur halb orientalisch, ist dennoch sehr glücklich gewählt; eben so charakteristisch als malerisch. Das ganze Bild des nur wenig bekannten Meisters wird stets in der Reihe der aus der Bibel entlehnten Kunstschöpfungen eine vorzügliche Stellung einnehmen.
==9. Heft.==
=== Der Schreibmeister. Von Gerard Dow.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 020.jpg|500px|center]]
Einen ungemein lieblichen, reizenden Eindruck macht es, wenn man unter den holländischen Meisterwerken der Kunst den Bildern des Gerard Dow begegnet.
Während die Bilder seiner Kunstgenossen, das niedere, nicht selten rohe Leben mit fast absichtlicher Verschmähung jeder Veredlung der Figuren darstellend, sich drängen, ist bei Dow Alles voll zartester Harmonie. Sanft und wohlthuend angesprochen, bewundern wir in seinen Gemälden einen idyllisch milden, wahrhaft poetischen Hauch.
Auch Dow band sich genau an die Wirklichkeit, genauer, als vielleicht irgend ein anderer Maler. Die geringsten Einzelnheiten sind bei ihm mit undenkbarster Sorgfalt gearbeitet; er ist derjenige Holländer, welcher drei volle Tage nöthig hatte, um einen gewöhnlichen Besenstiel darzustellen. Aber eben durch diese minutiose Sorgfalt, durch diese vollkommenste Wiedergabe der unbedeutendsten Dinge erreichte Dow die bewunderungswürdige Höhe in dem ihm eigenthümlichen Streben. ’’Er stellt das unendliche Behagen der heimischen Existenz, den vollen Frieden, die gesättigte Ruhe der Häuslichkeit dar.’’
Hier am heimischen Herde gewinnt das Geringfügigste Bedeutung. Alle Geräthe und Kleidungsstücke – deren Stoffe Dow täuschend malte – spielen ihre Rolle in der Lebensgeschichte der dargestellten Person. Durch den Anblick des bekannten, alltäglichen Beiwerks wird der Beschauer im Bilde heimisch; er fühlt sich gefesselt und gerührt. Die ganze Existenz harmloser Menschen rollt sich vor ihm auf, die Poesie wird lebendig und der Meister feiert seine Triumphe.
Gerard Dow ist unstreitig nach seiner durchaus richtigen Zeichnung, nach seiner herrlichen Färbung und seiner genauen Beleuchtung einer der ersten holländischen Genremaler. Er wird auch Dou oder Douw genannt und ist der 1613 zu Leyden geborne Sohn eines Glasmalers. Sein Tod erfolgte im Jahre 1680. Rembrandt war sein Lehrer; gleich ihm besaß Dow das Geheimniß der malerischen Harmonie im hohen Grade. Seine meist räumlich kleinen Gemälde sind sehr hoch geschätzt; die „wassersüchtige Frau“ ward mit 30,000 Gulden bezahlt; ebenfalls wurde unser Bild, der „Schreibmeister“, von der königlichen Gallerie zu Dresden zu einem ungemeinen Preise erstanden.
Wirklich ist dieser „Schreibmeister“ eine vollendet reine Perle Dow’scher Kunst. Jeder Zug, jede Linie im Bilde ist lebendig, und wenn jemals, so ist hier die gemüthlichste Ruhe, die heiterste Selbstzufriedenheit mit dichterischer Meisterschaft gemalt. Es ist vorzugsweise ein Bild, welches keine kritische Beschreibung erträgt, sondern empfunden sein will. Könnten wir daher auf den Inhalt des Gemäldes mit liebevollerer Genauigkeit eingehen, als dadurch, daß wir, während der Beschauung desselben, ein Stück poetischen Stilllebens hervorrufen? – Wir sind gewiß, daß wir damit zugleich die eigenthümliche Disposition in Dow’s Werken bezeichnen.
Gerard Dow konnte nicht wie die Teniers, Ostade’s, Brouwers und Bega’s die Vorbilder seiner Schöpfungen, den realen Grund seiner künstlerischen Phantasie und Conception, in jeder Dorf- oder Matrosenschenke finden. Er bedurfte eben so eigenthümlicher als anspruchsloser Charaktere und Situationen, welche sich zu Trägern der in dem häuslichen Leben sich spiegelnden Innerlichkeit eigneten. Ein wahres Pracht-Original dieser Gattung fand Dow’s sechzehnjährige Tochter Duyveke in einem alten, zu einer Armenschule eingerichteten Franciscanerkloster. Es befand sich hier ein kleines Gäßchen, daß Judengäßchen genannt, obgleich Amsterdam bekanntlich lange Zeit gar keine der Kinder des gelobten Landes innerhalb seines Weichbildes duldete. Auf dies dunkle Gäßchen sahen einige der gewölbten Fenster des Klosters, und vor demjenigen, welches am meisten durch einige Strahlen der Sonne begünstigt war, saß vom frühen Morgen bis zum späten Abende Rafael Huelst, der Schreibmeister für die Armenschüler. Der siebzigjährige, silberlockige Junggesell nahm aber noch einen wichtigeren Platz ein; er schrieb mit der damals fast zu Grabe gegangenen Kunst der alten Zeit Urkunden und Documente für die Kanzleien der Generalstaaten. Duyveke flog zu ihrem Vater und beschrieb den alten Rafael Huelst mit seinem Barett, seiner Klemmbrille und seinem, die glücklichste Selbstzufriedenheit ausdrückenden, charakteristischen Gesichte, nicht minder mit dem noch aus Kaiser Karls V. Zeiten stammenden halb-spanischen Oberkleide so hinreißend, daß Gerard Dow von seiner Staffelei bedächtig aufstand, höchst sorgfältig das in Arbeit befindliche Gemälde durch ein seidenes Tuch vor etwaigem Staube schützte und, die Mappe unterm Arme, seine die bewunderungswürdigste Sauberkeit zeigende Werkstatt verließ.
Dow konnte den Eingang zu der alten Schule nicht finden. Er trat daher, indeß er seinen großen Federhut nachlässig lüftete, dicht vor die graue Mauer von Rafael Huelst’s Fenster. Dow war entzückt, als er den Kopf des Schönschreibers prüfend betrachtete; als er den runden Sessel desselben, eine Sanduhr und das alte Pult mit vergilbten, zerrissenen Pergamenten erblickte, und oben an dem gewölbten Gestein einen Vogelbauer mit einem Gimpel darin und in der Schlafstube eine runde Laterne von eigenthümlicher, fast antiker Form entdeckte.
Huelst grüßte den blassen Meister mit großer Freundlichkeit, setzte aber, ohne sich stören zu lassen, seine Arbeit fort. Der Maler war durchaus kein Freund von Complimenten; er sagte heute aber dem Alten einige Artigkeiten, weil er, seinen Mann mit richtigem Blicke taxirend, neben der heitern Gutmüthigkeit desselben eine ziemliche Störrigkeit in seinen Zügen zu lesen glaubte. Huelst hörte mit bescheidenem, aber würdig-mildem Lächeln das Lob, welches Dow dem mit unendlicher Mühe gemalten großen <tt>„F“</tt>, dem Anfangsbuchstaben einer, mit <tt> „Frederik van Nassauen“ </tt> beginnenden Urkunde, spendete. Der Schreibmeister wurde heiter, er lud den Maler, obgleich seine Schüler versammelt waren, ein, in sein Zimmer zu kommen.
– Mynheer, ich werde Euch einige Pergamente zeigen, sprach Rafael Huelst stolz, auf welchen Ihr in jedem großen Buchstaben Malereien bewundern sollt, vor denen die Leistungen unserer Miniaturmaler in Nichts verschwinden. Ich halte mein Urtheil zurück, aber Ihr, der Ihr die Sache zu verstehen scheint, werdet offen gestehen müssen, daß unsere hochgepriesenen Maler, daß Dow, Mieris und Metzu gegen die Feinheit meiner Arbeit ihre Leistungen als Sudelei ansehen müssen!
– Dow thut’s ganz gewiß, lieber Meister Huelst! sagte der Maler still lächelnd. Ich bin’s selbst, deswegen kann ich dafür einstehen. Erlaubt, Mynheer, daß ich von Euch lerne; mein Wille ist der beste, den es geben kann. Besonders aber vergönnt, daß ich Euch male; ich möchte das Bild eines so ausgezeichneten Mannes täglich und stündlich vor Augen haben.
Der Schreibmeister starrte den Maler sprachlos an; dann stand er, bestürzt und aufgebracht zu gleicher Zeit, auf und ließ rasch den zur Seite geschlagenen bunten Vorhang herab, um sich mit seinem gekränkten Stolze, seiner beschämten Prahlerei zu verbergen. Mynheer Huelst, sonst ein sehr gottesfürchtiger Mann, fluchte vernehmlich; der Gimpel im Bauer, durch die Finsterniß erzürnt, schrie erbärmlich und fiel vor Aerger todt auf den Boden des Käfigs nieder. Beim Anblicke dieses Unglücks fing der alte Junggeselle auf’s Herzbrechendste zu Nagen an.
– Oh, Monbijou! rief er, seinen todten Liebling, große Thränen weinend, an die Lippen drückend. Stirb nicht, verlaß mich nicht! Du aßest aus meiner Hand und schliefst in meinem Busen! Du, mit der kleinen Kehle voll sanfter Lieder, mein Freund, mein Trost . . . da halt’ ich dich, deine arme Leiche, in meiner Hand und weine vergebens, um dich zu erwecken, den die Laune eines schändlichen, herzlosen, eingebildeten Malers hinopferte!
Dow sah ein, daß hier kein Trost nützen könne. Er schlich sich tief betrübt fort; aber eben diese Scene mit dem alten, armen Schönschreiber und seinem Dompfaffen zeigte ihm, daß nimmer ein Anderer als Rafael Huelst vollständiger für sein zartes, poetisches Darstellungstalent geschaffen sei. Er machte Anstrengungen, sich mit dem Schreiblehrer auszusöhnen, um ihn zu bewegen, daß er ihm sitzen möge; aber Huelst war unerbittlich. Und anders konnte Gerard Dow sich seiner nicht bemächtigen, denn er hatte sicherlich acht Tage nöthig, um den Alten zu zeichnen.
Die schöne Duyveke fand wiederum das Auskunftmittel. Sie ruhte nicht eher, bis sie, als sie bemerkte, der Bauer des Schreibmeisters sei noch immer leer, einen Gimpel auftrieb, der das Nationallied:
<poem>
<tt> „Wilhelmus van Nassauen
Ben ick van Duytschen Bloed“ u. s. w. </tt>
</poem>
vom Anfange bis zum Ende mit seltener Virtuosität pfiff. In einem prächtigen Käfig brachte das reizende Kind den neuen Montbijou nach dem Judengäßchen, trat in die Stube des Schreibmeisters und das Dompfäffchen schmetterte dem Alten die schwungreiche Melodie unter unzähligen Verbeugungen glücklich entgegen. Rafael Huelst faltete, indeß ihm Thränen in die Augen traten, andächtig die Hände.
– Montbijou! flüsterte er. Und ich armer Mann habe nicht Geld, um mir dies himmlische Vöglein zu kaufen . . .
Die Duyveke, selbst tiefer gerührt, als sie sich merken ließ, fing für ihren Vater Dow zu unterhandeln an. Der Schreibmeister widerstand nicht länger.
– Mit nichten, Meister Huelst, lächelte der eintretende berühmte Meister; ich will Euch auf keine Weise beschwerlich sein; der Staat und der Bratenrock ist überflüssig; ich möchte Mynheer Huelst gern so haben, wie ich ihn zum ersten Male sah . . . Und da trugt Ihr diese ewig unbezahlbare spanische Kapuze. . .
Dow hatte die Arbeit an einem seiner lieblichsten Bilder begonnen.
----
===Gabriel Metzu und seine Frau. Von ihm selbst.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 021.jpg|500px|center]]
Dieses Bild dieses geistreichen holländischen Genremalers ist im höchsten Grade anziehend durch seine Ungezwungenheit und edle Simplicität. Diese beiden Eigenschaften zeichnen durchgehends Metzu’s Werke aus; hierzu gesellt sich die höchste bis aufs Unbedeutende sich erstreckende Vollendung in der Ausführung, sowie das sauberste, klarste Colorit. Fein und gemüthlich, wie der Maler selbst, sind seine Stoffe; seine Auffassung zeigt uns immer den geistreichen Künstler, und mehre Gemälde von ihm, so sein „Laboratorium“, seine „Kranke mit dem Arzte“ stehen in erster Linie des Vorzüglichsten, was die niederländische Genremalerei überhaupt aufzuweisen hat. Metzu arbeitete, wie die sorgfältige Vollendung seiner Bilder schon schließen läßt, äußerst langsam. Dieses Umstandes und seines frühen Todes wegen ist die Zahl seiner Werke nicht groß. Sie haben daher, abgesehen von ihrer Vortrefflichkeit, sich zu einem ungeheueren Preise erhoben. Die vorzüglichsten Schüler dieses Malers, J. van Geel und van der Neer, bleiben weit hinter der geistreichen Zartheit ihres Meisters zurück.
Gabriel Metzu, oder wie der Name auch geschrieben wird, Metsu, ward in Leiden 1615 geboren, lebte zu Amsterdam und starb hier im Jahre 1658. Daß er ein Schüler von Dow war, dürfte schon bekannt sein.
----
===Die Dorfschenke. Von A. Ostade.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 022.jpg|500px|center]]
Adrian von Ostade, obgleich ein Deutscher (er wurde zu Lübeck 1610 geboren), gehört dennoch, da er sich in Holland bildete und alle charakteristische Merkmale der Holländer in seinen Werken zeigt, der niederländischen Malerschule an. Er nimmt in dieser einen hervorragenden Rang ein. Franz Hals und Rembrandt waren seine Lehrer. In genauer Bekanntschaft mit dem talentreichen Brouwer lebte er zuerst in Haarlem, dann in Amsterdam. Hier starb er 1685.
Ostade malt das Landleben, das Innere von Bauerhütten und Schenken; seine Personen sind größtentheils derbe Bauern, Betrunkene, Tabaksraucher, Bettelmusiker, Bäuerinnen bei der Arbeit. Er hatte mit Teniers viele verwandte Züge; aber dieser ist origineller, humoristischer als Ostade. Teniers’ Composition hat mehr Einheit als die, welche die zuweilen ganz willkürlich zusammengestellten Personen Ostade’s verbindet. Sodann wiederholt sich Ostade nicht selten und kommt Teniers in der Zeichnung nicht gleich. Seine Ausführung aber übertrifft diejenige des Holländers.
Ostade erfand wenig; aber wo er die Komik im wirklichen Leben erfassen und in seine Gemälde übertragen konnte, da ist sie schlagend. Neben einem kleinen Gemälde, worin sich der Künstler neben seiner Frau und mit acht Kindern darstellte, welches das Pariser Museum besitzt, ist unser Bild eine seiner reizendsten Schöpfungen.
Es zeigt auf interessante Weise, wie Adrian von Ostade zu componiren pflegte. Adrian besaß einen 1612 geborenen Bruder, Isaak van Ostade. Dieser war sein Schüler und stand ihm in Zeichnung und Colorit weit nach, weswegen Adrian in der Regel der ''„gute Ostade“'' genannt wird. Isaak machte unter der Aegide seines Bruders seine Naturstudien an den Orten, welche Adrian gewöhnlich darzustellen pflegte.
– Aber das ist ja noch immer kein Bild! klagte dann Isaak, wenn Adrian begeistert zu dem Stift griff, um die Scenen vor sich fest zu halten.
Eines Nachmittags, als die beiden Künstler zu einem Dorfe am Haarlemer Meer wallfahrteten, wurden sie von ihrem Nachbar begleitet, der Mappen und Zeichnengeräth trug. Dieser Nachbar war ein Schuster und dazu ein Franzose von Geburt. Damals war’s eben in der Zeit, daß König Ludwig XIV. von Frankreich die Niederlande mit seinen Heeren bedrohete. Der Schuster, welcher früher, sobald er Miene gemacht, als patriotischer Franzmann zu glänzen, von den Holländern regelmäßig mit Schlägen zur Ruhe gebracht war, faßte bei dieser Nachricht frischen Muth. Gleich als sei er König Ludwigs außerordentlicher Abgesandter, ging er Haus bei Haus in seiner Nachbarschaft, machte sich wichtig, drohte in Frankreichs Namen, legte vorläufig Brandschatzungen auf, und hatte die Genugthuung, daß die erschreckten Holländer ihm erstaunt zuhörten, ohne ihn zu züchtigen.
Als der französische Fußbekleidungskünstler, die Mappen und Feldstühle schleppend und dazu heftig aus seiner Thonpfeife rauchend, hinter den beiden Malern herkeuchte, trieb er seinen Patriotismus so weit als möglich, indeß Adrian dem seufzenden Isaak die Geheimnisse der Kunst zu enthüllen bemüht war.
– Aber da habe ich immer noch kein Gemälde! bemerkte Isaak unverbesserlich.
– Ei, Gewitter! rief Adrian, in seiner Aufgeregtheit plötzlich deutsch fluchend und sprechend. Was giebt, was macht denn ein Bild? Alles, Alles – Schwachkopf – vom Blitze an aus dem hohen Himmel heraus, bis zu dem kleinsten Käfer und Wurm im Grase – Alles sind Bilder! Leben, Bruder, mags heißen wie’s will, erscheinen wie’s mag, Leben, nur Leben, und Du hast die Bilder, die Du nirgend finden kannst!
– O, raisonniren kann ich auch über dergleichen, theurer Adrian! sagte der sanfte Isaak, noch lange nicht überzeugt.
Adrian sah ihn einen Augenblick fest an. Dann wandte er sich zu dem Schuster, der noch nicht zu bramarbasiren aufgehört hatte, und sagte befehlend zu ihm:
– He! Sans-Regret! Siehst Du da das Wirthshaus? Hier nimm diesen Gülden, laß Dir Wein geben, setze Dich an irgend einen Tisch und erzähle Jedem, der es hören will, was Du uns vornäseltest. Verkündige den Mynheers da drinnen die Nachricht, daß König Louis <tt>quatorze</tt> auf Deine Veranlassung die Niederlande in ein Sodom und Gomorrha verwandeln wird . . .
– Aber das wird eine Bataille . . . bemerkte der Franzose.
– Marsch doch, Sans-Regret! Ich bezahle Dir Deine Prügel.
Der Schuster strich seinen schwarzen Bart, rückte die Pelzmütze und ging in die Dorfschenke. Adrian und Isaak nahmen draußen am Fenster Platz. Der „gute Ostade“ hielt, indeß seine Augen blitzten, den Bleistift auf dem glatten Papier.
– Jetzt sieh, Du ungläubiger Thomas! murmelte Adrian, die Zeichnung beginnend, wie in einer prachtvoll perspectivischen Hütte im Vordergrunde der Schuster mit unwiderstehlich ergreifender komischer Würde fünf Holländern, die um einen Tisch saßen, ihr verderbliches Schicksal ankündigte, während sich einige Männer im Hintergrunde durch rasches Trinken begeisterten, dem übermüthigen Gliede der „großen Nation“ mit ihren geballten Händen den Mund zu stopfen.
– Herrlich! Herrlich! rief Isaak, jetzt ebenfalls warm werdend. Diese verschiedenen Physiognomien der Mynheers sind zu unübertrefflich. Und Sans-Regret ist heute ein ganzer Mann! Das wäre freilich ein Bild!
– Und kein schlechtes! schloß Adrian. Des Künstlers Auge hat aber sicherlich in ihm noch sein ''letztes'' nicht gefunden!
Er schloß die Mappe zu, eben als dem Schuster von den übrigen Gästen der Lohn seines Patriotismus in fühlbarer Weise ausbezahlt wurde.
----
===Die Eierprobe. Von Gottfried Schalken.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 023.jpg|500px|center]]
Schon mehre Male traten wir in den heitern Kreis der Maler Hollands, von denen Gerard Dow den Mittelpunkt bildet. Wir kennen den Meister selbst, seinen wilden und genialen Mieris und den stillen und feinen, durchbildeten Metzu. Der dritte seiner besten Schüler ist nicht weniger bedeutend, als diese beiden; steht in der Art seiner Auffassung unabhängig von ihnen, die viele Aehnlichkeiten bieten, da, und übertrifft an effektreicher Darstellung und Beleuchtung diese Miniaturisten, die mit Aengstlichkeit die kühnere Pinselführung zu vermeiden strebten.
Es ist dieser dritte Gottfried Schalken, von Dortrecht, welchen Zusatz sein Name in der Regel führt. Wenn Mieris unter den Freunden das überkräftige Leben, den Humor und die Ausgelassenheit, Metzu dagegen die geistreiche Gemüthlichkeit vertrat: so paßte Schalken ganz vortrefflich, um dem Kleeblatte durch seinen melancholischen Ernst das Element zu geben, welches ihm noch fehlte, um ein Ganzes zu sein. Mieris konnte raisonniren, Metzu sich fein unterhalten und sprechen; Schalken verstand das Betrachten und Grübeln aus dem Grunde.
Der Letztere hatte indeß eine Eigenschaft, die, obwohl sie mit seinem ernsten Wesen, welches er gewöhnlich zeigte, im geradesten Widerspruche stand, gar nicht selten, obgleich lange nicht so oft hervorbrach, wie es etwa Mieris wünschte. Schalken hatte die herrlichste Anlage, die komischsten Vorfälle anzuzetteln. Er lachte selten, war aber im Stande mit einer wahren Leichenbitter-Miene so lange die witzigsten, possenhaftesten Sachen von der Welt vorzubringen, bis seine Freunde ihn unter dem unauslöschlichsten Gelächter um Schonung ihres Zwerchfells und um die Gnade baten, sich wieder in menschenfeindlichen Betrachtungen zu ergehen.
Mieris war die Seele der Gesellschaft. Aber wenn seine Hilfsquellen der Unterhaltung versiegt waren, dann konnte man drauf rechnen, daß Schalken sich in seiner Glorie erhob. Er machte Kartenkunststücke, in deren Geheimniß noch Niemand seiner Freunde hatte einzudringen vermocht. Schalken besaß eine ganze Reihe von Bildern, die er durch die einfachste Vorrichtung so zu beleuchten verstand, daß die frappantesten, grausigsten und lächerlichsten Scenen in Lebensgröße mit herrlichster Wahrheit sich frei im Zimmer schwebend darstellten. Metzu war namentlich ein Freund dieser in einem halbdunklen Gemache stattfindenden Unterhaltungen; er war es, welcher Gottfried Schalken am meisten quälte, wieder einmal zu „hexen“. Diese Bilder selbst hatten die Freunde noch nie gesehen. Mieris wollte endlich den gordischen Knoten mit dem Schwerte, oder vielmehr der Brechstange durchhauen: er sprengte einst in Abwesenheit des Dortrechters dessen Schlafkammer auf, wo sich die magischen Gemälde befanden, während ein halbes Dutzend Maler neugierig vor der Thür harrten. Als sie hervorgebracht wurden, diese Bilder, waren nichts als wüste Striche und bunte Kleckse zu sehen, aus denen selbst die Maler nichts als ein Chaos heraus zu finden vermochten, Zeichen genug, daß sie die Lichteffecte bei weitem nicht so genau kannten, als ihr schwermüthiger Freund.
Als Schalken diese „Kirchenräuberei“ erfuhr, konnte er kaum abgehalten werden, mit Mieris den langen Stoßdegen zu kreuzen. Glücklicherweise ließ sich indeß der Dortrechter mit einem Eierpunsch, dessen Grundstoff echter Schiedamer war, sicher besänftigen; denn er gab, was die Liebe zum Becher betraf, dem Mynheer van Mieris, welcher in diesem Punkte groß war, wenig nach.
Die Punschbereitung, die Anfertigung des Ei-Schiedamers blieb stets Mieris überlassen. Bei einem solchen Anlasse war’s, daß Schalken eins seiner Kunststücke producirte. Die Gesellschaft war eines Abends beim Mieris in seinem Atelier versammelt. Die Freunde saßen um den Tisch und warfen ihre Geldstücke zusammen.
Dann schrie Franz: – Jantje!
Die Dienstmagd der Wirthin, der Liebling der Maler, erschien. Statt aber wie sonst selig zu lächeln, war das achtzehnjährige Mädchen heute wo möglich noch melancholischer als Schalken, welcher schon seit einer Viertelstunde unverwandt eine Laokoon-Statue auf einem Nebentische anstarrte, ohne ein Wort zu sprechen. Sogar die Rosenwangen Jantje’s schienen verblaßt; ihr krauses Haar hing unordentlich, aber noch immer schön um ihre Stirne.
– Was machst Du heut Abend für Gesichter, Mädchen? rief Mieris aufblickend. Ist Dir Dein Liebhaber etwa ungetreu geworden? Statt der Antwort machte das Mädchen Anstalt zu weinen. Jetzt standen die Maler auf und stellten sich um sie und bestürmten sie so lange, bis sie gestand: ihr Geliebter sei ein Fischer, der nothwendig ein Boot heirathen müsse.
– Ein Boot? riefen die Jünglinge.
– Ja, ein Mädchen, das ein Boot besitzt, sonst giebt’s der Vater Pieter’s nicht zu, und mein Freund muß eine Andere, Reiche freien. . . Und ich bin so arm . . .
– Ah bah! Heule nicht! sagte Schalken barsch. Hol’ die Eier für unfern Schiedamer und dann wollen wir gelegentlich ’mal weiter sehen.
Jantje nahm sehr bestürzt das Geld und ging. Als sie wieder erschien, hatte sie noch dieselbe schüchterne Miene; sie schien nur mit Gewalt ihre Thränen zurückzuhalten. Kaum wagte sie es, den geflochtenen Weidenkorb, fast schier mit den schneeweißesten Eiern gefüllt, den Jünglingen, von denen sie Trost in ihrem Schmerze erwartet haben mochte, auf den Tisch zu setzen.
– Die Eier sehen ja verdächtig aus! rief Schalken abermals und mit höchst finsterer Miene. Zeigt doch eben; wenn die nicht faul sind, so heiße ich nicht Gottfried.
Und er nahm ein Ei und warf’s ohne Umstände auf den Fußboden. Wortlos sah Jantje zu. Plötzlich aber stieß sie einen hellen Ausruf aus und bückte sich rasch, indeß sie die Hand ausstreckte und dennoch nicht wagte zuzugreifen. – Mitten in dem zerfließenden Dotter lag nämlich ein glänzendes Goldstück.
– Ei! sagte Schalken sehr ernst. Das ist zu seltsam, um das Ding nicht noch einmal zu versuchen. Geht das so fort, so werden die Goldstücke hierlandes sehr wohlfeil werden.
Und abermals zerwarf er ein Ei – wieder zeigte sich das Gold drin; noch eins – dasselbe Resultat.
Jetzt starrte Jantje die Freunde mit einem großen Blicke an, besann sich rasch und stürzte auf den Korb mit Eiern los, den sie fest an sich drückte.
– Ich habe die Eier gekauft; mir gehören sie! Ich hole den Herren einen Gulden, den ich dafür bezahlte, und mögen sie dann andere kaufen! O guter Gott! Welches Glück! Welches Wunder! Mir so das Geld zu bescheren, damit Pieter der Meinige wird.
Und das Mädchen rannte zur Stube hinaus. Die Maler sahen sich an und brachen wie auf’s Signal in ein langes Gelächter aus. Auch Schalken wurde heiter.
– Wollen doch sehen, was sie beginnt; murmelte er, indeß er ihr nacheilte.
In der Küche war Licht. Die Maler blickten neugierig durchs Fenster.
Da saß die schöne Jantje vor ihrem mit einem großen Bunde Zwiebeln prangenden Tische, auf welchem die Thranlampe stand, den Korb noch fest auf dem Schooße haltend und mit glücklichem Lächeln ein Ei vor die Flamme haltend, in welchem sie schon jetzt das Goldstück zu erblicken meinte.
– Seht doch, Jungen! flüsterte Schalken mit seiner Baßstimme. Ist das nicht ein superbes Bild? Heda! sagte er, in die Küche tretend, komm, gutes Kind; bemühe Dich nicht, die Goldstücke sind ausgeflogen; aber, meiner Seel’, Dir sollen sie dennoch nicht fehlen.
Jantje aber wollte sich nicht von den Eiern trennen. Sie schlug sie eigenhändig mit zitternden Fingern und erwartungsvollem Blicke in die Schiedamer-Schale und brach, als selbst das letzte kein Gold zeigte, in helle Thränen aus.
– Ruhig! Setz’ Dich später noch einmal hin, wie eben! Ich male Dich und dann wartest Du acht Tage. Du wirst Dein Geld schon erhalten, dessen Du bedarfst. Hast Du, Mopskopf, vergessen, daß wir, wie Meiris sagt, Leute sind, deren Stunden jede drei Ducaten werth sind?
Schalken malte Jantje und gab ihr das Honorar für das Bild als Aussteuer, während der verschuldete Mieris ihr den Hochzeitsstaat und der sparsame Metzu ein Boot am Tage der Trauung schenkte.⏎
⏎
{{References|LIN}}
[[Kategorie:Kunstwissenschaft]]
This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|