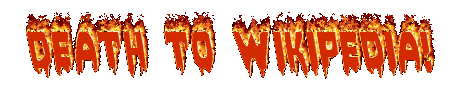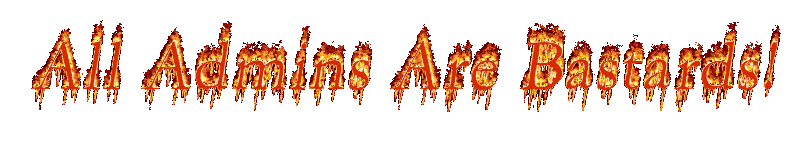Difference between revisions 1998023 and 1998091 on dewikisource{{LineCenterSize|100|23|Der}}
{{LineCenterSize|160|23|'''KUNSTVEREIN.'''}}
{{Linie}}
{{LineCenterSize|100|23|NEUE SERIE:}}
{{LineCenterSize|110|23|''Stahlstich-Sammlung der vorzüglichsten Gemälde''}}
{{LineCenterSize|90|23|der}}
{{LineCenterSize|140|23|DRESDENER GALLERIE.}}
(contracted; show full)orletzte Manier hielten und wirklich Manieristen und Epigonen wurden. Von den Schülern die Reni bildete, haben Gessi, (dessen Magdalena wir geben) Simone Contarini, Andrea Sirani und beziehungsweise dessen Tochter Elisabetta, Semenza, Domenico, Maria Canuti und Gignani den meisten Ruf erhalten. Eine weichliche, zierliche und unkräftige Weise der Malerei ist das Bezeichnende für fast sämmtliche Leistungen dieser Schüler.
Guido Rem starb 1642 in Bologna, wo er in der Kirche zu San Domenico begraben liegt.
==23. Heft.==
===Viehstück. Von Adrian van der Velde.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 060.jpg|600px|center]]
Eine reizende Gewandtheit besitzt van der Velde, das Idyllische, die tiefste, glückliche Einsamkeit des Landlebens, wahr und ansprechend zu malen. Seine Hirtenstücke werden, was die Zwanglosigkeit ihrer Composition, das in ihnen ausgeprägte tief innere Genügen, ihre heitere, lebenvolle Ruhe betrifft, sicherlich unübertroffen bleiben. Meist ist die Landschaft selbst bei van der Velde nicht von überwiegender Bedeutung und seine Staffage erhebt sich nicht selten zum Genrebilde, dem indeß ein gewisses Zerstreutes, zufällig Zusammengebrachtes fast immer anklebt.
Van der Velde’s vorliegendes Bild ist, was die Kunst des Malers betrifft, Thiere darzustellen, gewiß von besonderer Bedeutung. Seine Auffassung des Charakters der Hausthiere ist leicht und zwanglos und dennoch von großer Wahrheit, obgleich van der Velde in genauer, charakteristischer Zeichnung und gleicher Weise in der eigenthümlichen Gruppirung der Thiere weder dem Roos, noch dem Berghem, oder dem Wouvermann und Wenix gleich kommen dürfte. Hauptsache ist bei van der Velde außer der herrlichen Behandlung des Baumschlages eine lichtvolle, wahre und warme Malerei, welche über seine Genrestücke und Landschaften einen stillen, aber mächtig ergreifenden Zauber ausgießt. Auf unserm Bilde hat sich der Meister darin gefallen, eine ganze Reihe von Hausthieren zu malen, Kühe, Schafe, Ziegen, Schweine, ein Pferd und Hühner. Das Bild ist von allem Frappanten, drastisch Wirkenden der Composition durchaus entkleidet; es würde eine fast antike Einfachheit athmen, wenn namentlich die kleinen Ziegen wegfielen, deren unruhige Bewegung nicht zu der Stille des Bildes paßt. Ein ächt holländischer Zug von Komik ist in einem nicht wohl näher anzudeutenden Punkte ausgesprochen.
----
===Der Zahnbrecher. Von Geraart Honthorst.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 061.jpg|600px|center]]
Man konnte die beiden Männer auf dem halb erleuchteten, weiten Flur kaum erkennen.
Der Eine war eine wahre Riesengestalt, hochbeinig, sehr breitschulterig, ein angehender Fünfziger. Dieser trug einen ungeheueren Federhut und war ungeachtet der Abendstunden in höchster Galla: in weiten Pluderhosen, seidengepufftem Oberwamms und mit einem Sammtmäntelchen versehen, wie die Gerichtspersonen es zu tragen pflegten. Dieser Coloß hatte seinem Körper gemäß ziemlich grobe Züge; große wasserblaue Augen und einen gewaltigen struppigen Bart. Sein Haar spielte ins Graue und stand in unregelmäßigen Partien starr unter dem Hute hervor.
Der Andere war ein höchst elegant gewachsener und schön gekleideter Herr von ein und zwanzig Jahren, mit frischem, schalkhaftem Gesichte, braunen Haarlocken, mit einem Stutzerhute auf dem Kopfe, und in ein Jagdwamms gekleidet. Auch trug er einen reichen Hirschfänger durch eine goldgestickte Schärpe um die Hüften geschürzt.
Die Männer waren in angelegentlichster Unterhaltung. Der Alte schien sehr aufgeregt und predigte auf den Jüngling, zwar mit unterdrückter Stimme, aber höchst eifrig ein. Dasjenige, was er vortrug, war sicherlich für ihn eine Sache von außerordentlicher Wichtigkeit, – eine Lebensfrage.
Diese Personen waren: der Alte, Mynheer Claas van Slyker, Stadthouder der guten Stadt Amsterdam, und der Jüngling, Hendrik Ter Schuiring, ein nordholländischer Edelmann, und der Bruder der Baronesse Elizabeth von Leuwenbroeck, der Eigenthümerin dieses Gebäudes, welches wohl den Namen eines Palastes verdiente.
– Ich versichere Euch, Herr Junker Ter Schuiring, sagte der Rathsherr, indeß er ihm ein Schächtelchen, reich mit Gold und Perlmutter verziert, aufzudringen suchte, daß es die ausgezeichnetsten Kindern Flora’s sind, welche sich aus diesen kostbaren Keimen entwickeln werden. Ja kostbar! Dritthalbtausend Gulden, wie der Haarlemer Blumist bescheinigen kann! Aber was sind diese Gulden gegen ein einziges Lächeln Eurer huldvollen Schwester . . .
– Mynheer, erwiderte Hendrik, den Hut ungeduldig rückend und den Alten mit einem blitzenden Blicke betrachtend; dieses geht mir dennoch über den Scherz hinaus. Ich fürchte wahrlich – gerade heraus – für Euren Verstand . . .
– Ach ja, seufzte Slyker, an seine Stirn fassend, Ihr habt sehr Recht! Sagt nur, ich bin wahnsinnig – aber diese Obstruction in meinem Kopfe ist aus einer der erhabensten Leidenschaften hervorgegangen . . .
– Geht, geht doch! Träfe Euch Leuwenbroek, so könnte sich eine unangenehme Scene für Euch ereignen! sagte Hendrik, welcher das Kästchen, das ihm der Rathsmann geschickt in den Arm gelegt hat, vergebens wieder zurückzugeben versuchte.
– Mag der Baron kommen! rief Slyker jetzt beinahe mit lauter Stimme. Ich weiche nicht, bevor ich ein Wort des Trostes von der schönsten Dame Amsterdams empfangen habe! Gern will ich für Elizabeth der Gefahr trotzen, von Eurem Schwager hier ermordet zu werden!
– Gijsbert Leuwenbroek, sagte Hendrik, allmälig aufgebracht werdend, wird Euch, Mynheer, nicht ermorden, sondern von seinen Dienern durchprügeln lassen. – Geht, oder ich selbst werde Euch in Abwesenheit des Hausherrn für Eure Unverschämtheit züchtigen. Wie? Soll eine geachtete, tugendhafte Dame, die Gemahlin eines angesehenen Edelmannes, durch die Narrheit eines alten Tropfes in Gefahr kommen, den tadellosen Glanz ihres Rufs einzubüßen?
Slyker war durchaus nicht aufgebracht, wie man es hätte erwarten sollen. Er zeigte eine große Niedergeschlagenheit.
– Urtheilt von meinen Empfindungen, sagte er mit tragikomischem Pathos, wenn ich Euch nochmals inständig bitte, mir nur auf zehn Minuten mit der Baronesse Leuwenbroek ein Gespräch unter vier Augen zu vermitteln. Ihr könnt Eurerseits von einem Millionair, wie ich bin, einigen Nutzen für Eure Gefälligkeit erwarten. Fordert und ich bin bereit, Euch zu dienen . . .
– Noch ein Wort, unterbrach ihn Hendrik mit Eiseskälte, und Ihr erhaltet Ohrfeigen. Die Achtung vor Eurer Stellung bewegt mich, Euch dieses zuvor anzuzeigen; Ihr hättet Eure Belohnung sonst schon empfangen.
– Und Ihr, mein Herr, sagte Slyker, sich stolz aufrichtend und die Hand an seinen Degen mit einem schön geflochtenen, goldenen Korbe legend, und Ihr hättet, wäre ich nicht in Eure Schwester verliebt und hätte ich nicht auf Euch und Eure Vermittelung meine Hoffnung gesetzt, schon das Vergnügen gehabt, nach Eurer ersten Beleidigung gegen mich niedergestoßen zu werden.
Eine Pause trat ein. Hendrik schien nicht mehr zu wissen, was er diesem Manne gegenüber sagen sollte.
– So aber, fuhr Slyker fort, bitte ich Euch nochmals. Nehmt dieses Kästchen, gebt es Eurer Schwester, klagt ihr meine Leiden; vergeßt sogar dieses Gespräch nicht, denn es beurkundet mehr, als alle Versicherungen, meine Liebe und versprecht mir, daß Ihr ein gutes Wort für mich einlegen wollt.
Hendrik sah den Alten groß an, sagte aber nichts. Bevor er sich genug gesammelt hatte, um antworten zu können, schlüpfte ein altes Frauenzimmer, nach flandrischer Sitte ein buntes Tuch um den Kopf gewickelt, die Stufen einer weiten Treppe herab und kam an die beiden Männer heran.
– Mynheer Hendrik, murmelte sie, und auch Ihr, Mynheer Slyker, Ihr solltet doch wissen, daß man solche Angelegenheiten, wie Ihr sie verhandelt, nicht mit Posaunenstimmen bespricht.
– Ach, Agathe! sagte Slyker erfreut, als er die alte Wärterin Elizabeths erkannte. Offenbar war sie ihm sehr günstig gestimmt.
– Und weiter sind dies Sachen, welche von Männern allein niemals gehörig in Ordnung gebracht werden können. Wir haben auch ein Wort dazu zu sagen und ich insbesondere, Mynheer Slyker, wenn Ihr erlaubt. Ich habe Alles angehört; ich weiß, wie das Spiel steht. Sage Euch, Mynheers, mit einem Worte, was ich will: Ihr, Mynheer, nehmt bis auf Weiteres Eure Tulpenzwiebeln wieder mit nach Hause, und Mynheer Hendrik und ich wir werden über das Fernere uns zu verständigen suchen. Auf jeden Fall werdet Ihr die Baronesse allein sprechen, wenn Ihrs wünscht: das kann des Anstandes und Eures Ranges wegen keine Dame der Welt, und wäre es die Königin von Spanien, abschlagen!
Es fehlte wenig, so hätte der verliebte Rathsherr die Alte vor Freude umarmt.
– Du giebst mir das Leben wieder, Agathe! sagte er. Ich fasse wieder Hoffnung und Muth . . .
– Davon später, Mynheer! sagte die Alte. Uebrigens wird Mynheer vom Hause, der Baron Leuwenbroek, sehr bald zurückkehren . . . Würde vielleicht Euch oder dem Herrn unbequem sein . . .
– Verstehe! Verstehe! Aber ich . . .
– Sollt Alles wissen; werden Euch Nachricht von unserm Entschlusse geben; dürft später fragen und sagen, was Ihr wollt, und sollt auf der Stelle Resolution haben . . . plapperte die Flamländerin.
– Ach die Resolution! seufzte Slyker. Ihr wollt mich ab und zur Ruhe verweisen . . .
– Wer weiß? sagte Agathe.
– Wirkt mir das Rendezvous aus, Agathe; ein Wort so gut wie tausend und ich werde mich so dankbar zeigen, als wäre ich der König beider Indien und nicht der bescheidene Rathsherr der alten Stadt Amsterdam.
Und in stolzester Demuth hob er sich empor, so daß er wenigstens noch zwei Zoll länger wurde.
Agathe sah ihn mit ihren großen, klaren Augen starr an. Eine sonderbare Bewegung zuckte über ihr schmales, faltiges Antlitz. Einen Augenblick richtete auch sie sich stolzer auf, sie sah verachtend auf den Graubart – dann aber verschwand dieser Ausdruck schnell und spurlos und sie fiel wieder in ihr Plappern, welches durchaus theilnahmlos, fast gedankenlos schien.
– Rendezvous? Ihr verlangt viel, sehr viel! Wollen aber sehen. Glaube nicht, daß Baronesse Elizabeth . . . Und doch . . . Wer ergründete das Herz eines Weibes?
Slyker drückte enthusiastisch die dürre Hand der alten Amme. Sie entzog sie ihm heftig.
– Jetzt geht! drängte sie. Ihr wißt ja jetzt – und wir wissen auch – sollt Nachricht haben!
– Aus Gnade, noch ein Wort . . . Wann? Wann?
Agathe blickte sinnend auf einen Fleck, dann faßte sie den alten Herrn fest ins Auge.
– Ihr wollt’s . . . erwiderte sie und ihre Stimme hatte einen eigenthümlichen, fast boshaften Ton angenommen. Sollt Euren Willen haben. Haltet Euch bereit . . . Nachricht wenigstens erhaltet Ihr in Zeit von einer Stunde. Nun aber: lebt wohl!
Slyker, sein Kästchen mit Tulpenzwiebeln unter’m Arm widerstrebte nicht, um die Alte nicht etwa in üble Laune zu versetzen, sondern empfahl sich und ging nach der Thür. Er war fast berauscht vor Freude. Als er auf die Straße kam, mußte er, ein amsterdamer Kind, still stehen und sich erst besinnen, welchen Weg er denn einzuschlagen habe, um nach seiner Wohnung zu gelangen.
Zu Hause angekommen, warf er sich in größter Bewegung auf sein glänzendes Lotterbettlein. Dann sprang er auf und musterte sich im Spiegel. Der sonst so kalte und unerschütterliche Hagestolz, in seinem Alter von dem Strahl aus den schönen Augen einer jungen Dame fast zauberhaft berührt, empfand das volle Fieber von Qual, Schmerz, Hoffnungslosigkeit und Sehnsucht, welches im Frühling der Gefühle die jugendliche Brust durchzuckt.
Indeß der Alte, mit großen Schritten auf und abmarschirend und wie ein neuer Roscius gesticulirend, einen glänzenden Monolog hielt, steckte die alte Agathe plötzlich den Kopf in’s Zimmer.
Slyker schrie fast auf. Die Dame trat ein und machte ihm eine Meldung, die er selbst in seinen kühnsten Phantasien, wenigstens noch heute Abend nicht, für möglich gehalten hatte.
Wir sind die vermittelnde Scene dem Leser noch schuldig.
Als Mynheer Slyker den Palast Leuwenbroek verlassen hatte, sah Hendrik die alte Agathe starr an; dann setzten Beide die Hände in die Seiten und fingen auf’s Signal ein Lachduett an, welches kein Ende nehmen zu wollen schien. – Beide hatten sich vollkommen verstanden.
– Aber wie, gute Agathe? brachte Hendrik dann hervor. Wie soll dieser Schwachkopf bestraft werden? Ich sehe, daß ich ihm gegenüber, wenn ich mich mit Dir vergleiche, eine alberne, durchaus der Gewandtheit ermangelnde Rolle gespielt habe. Ich überlasse es daher Dir, die Züchtigung dieses Narren zu unserer Revanche und zu seinem Wohle zu bestimmen. Sie darf aber weder zu gelinde, noch zu grausam sein . . .
– „Etwas Grausamkeit ist spanische Mode,“ sagte Moritz, als der spanische Cardinal-Legat für Oldenbarnevelt bat! erwiderte Agathe sehr heiter. Ich versichere Euch, Ihr sollt zufrieden sein und Mynheer Slyker ebenfalls. Laßt uns gleich Hand an’s Werk legen.
– An welches Werk? flötete eine weiche Stimme dicht hinter den Verschwörern.
Elizabeth Leuwenbroek wars, in der That reizend genug, um einem Dutzend der „ehrenfestesten“ alten Rathsherren die Köpfe zu verdrehen. Sie lauschte halbernst auf die Nachricht von dem Besuche des Herrn Slyker, verdammte aber, obgleich ihr der ganze verliebte Unsinn desselben berichtet war, dennoch die beabsichtigte Züchtigung des Alten.
– Ich verbiete Euch, sagte sie eindringlich, Euch an dem Menschen zu vergreifen, laßt ihn mit seiner Marotte seinen Weg gehen; denn er ist seiner Ueberspanntheit wegen eher zu bemitleiden als zu verdammen . . .
Hendrik murmelte und Agathe schüttelte den Kopf, als Elizabeth abging.
– Wir werden dennoch? fragte der Jüngling.
– Sicher! Wer kehrt sich an die Dame? Sie hat schon Mitleid mit dem Narren, weil er sie schön findet . . . Gut, Mynheer Slyker, wir werden wetten, daß Ihr sobald Niemand wieder mit Euren Huldigungen beglücken sollt, um Euch das Mitleid einer schönen Dame zu erschleichen! – Baron Hendrik, laßt Pieter und Dirk und Jan kommen, wir gehen sofort ab, um unseren Plan auszuführen. Daß die Leute aber ordentliche Stöcke mitnehmen . . .
– Aber geschlagen wird er auf keinen Fall! meinte Hendrik rasch.
– Fügen muß er sich, fügen, und da werden die Stäbe nicht unnütz sein.
Die drei Trabanten erschienen mit ihren Stöcken. Jan, der Koch, war jung, mit einer dicken Pelzmütze auf dem Kopfe; Dirk war der Jäger, ein durchwettertes Gesicht, und Pieter, mit einem Apostelbarte und grauem Kopfe, war der alte Kutscher. Sie sahen sehr unternehmend aus. Agathe ging voran und Hendrik folgte mit den dienstbaren Geistern. Der Zug ging zuerst nach dem Hause des Rathsherrn. Wir haben Agathe schon ankommen gesehen.
– Folgt mir, Mynheer! sagte die Alte mit sibyllinischer Kürze.
– Ich werde also Elizabeth – sehen – brachte der Ueberraschte hervor.
– Folgt mir nur! Macht Euch aber etwas unkenntlich. Legt Eure Staatskleidung ab und geht im Wamms mit; Eure Erscheinung könnte sonst Verdacht erregen.
– Das ist wahr! murmelte Slyker und legte rasch das überflüssige Zeug ab, setzte eine Mütze auf, nahm seinen Stock, aus Rücksicht auf eine podagristische Zehe, in die Hand und hinkte hinter der alten Dame her. Die Uebrigen folgten in einiger Entfernung.
Dame Agathe schritt wacker darauf los und vertiefte sich in entlegene Stadttheile.
– Immer fort! rief sie, wenn Slyker bedenklich still stehen wollte. Und er ging wieder. Bei einem niedrigen Häuschen bat sie ihn einzutreten. Sie blickte nochmals aus der Thür und nun drängten sich Hendrik und die Diener auch auf den engen Flur. Slyker hatte sich in eine Ecke geflüchtet. Der Inhaber des Hauses erschien mit einem Wachsstocke in der Hand; ein schöner, großer, verschmitzt sehender Mann, und lud die Gäste ein, näher zu treten.
– Allons! Mynheer! riefen Agathe und Hendrik, indeß die Diener die langen Stäbe aufhoben. In die Stube hinein!
Der arme Slyker mußte hervor und ging halb sein Geschick ahnend, mit einem bewegten Blicke auf das Heer seiner Feinde in das Zimmer. Der große bärtige Herr setzte sehr höflich einen Stuhl hin.
– Wem ist’s von Euch gefällig? fragte er, eine Zange von der Wand nehmend, wo mehre Instrumente eines Zahnarztes hingen.
Hendrik zog den Rathsherrn auf den Stuhl.
– Mir? Das glaube der Teufel . . . stammelte Slyker . . . Habe in meinem Leben keine Zahnschmerzen gehabt . . .
– Ihr habt jetzt Angst, sagte der Zahnbrecher, dann pflegt sich’s auf eine Minute zu geben aber heraus muß er, das ist so sicher wie Amen nach der Predigt.
– Versteht sich, Meister! rief Hendrik. Gebt mir die Kerze und thut Eure Schuldigkeit. Mynheer, wollt Ihr Euch in die entsprechende Positur bringen, oder nicht?
Mynheer Slyker gab sich gefangen.
– Welcher ist es? fragte der Meister, an einige Zähne klopfend.
– Der da! rief Agathe, auf den Eckzahn in der Unterkinnlade deutend.
Mynheer Slyker wollte noch sprechen, aber die Zange war ihm schon im Munde – der Zahnarzt stand hinter ihm. Hendrik leuchtete; Pieter stützte sich auf sein Knie und sah aufmerksam zu; der Jäger hatte die rechte Hand des Rathsherrn gefaßt und der Koch zog den Geldbeutel, um den Meister zu bezahlen. Dieser sah am mitleidigsten aus. Agathe zeigte sich, stoisch ihr Werk betrachtend, im Hintergrunde. Der Meister aber und Hendrik lachten, wie ausgemachte Schalke.
Es krachte und Mynheer sprang mit triefenden Augen und verstörter Miene auf, indeß der Meister den kerngesunden Zahn triumphirend in die Höhe hielt. Nur einige Augenblicke besann sich der alte Hagestolz, welcher so grausam-komisch getäuscht wurde, dann wankte er, für die übrigen Zähne und für seine fast ausgerenkte Kinnlade fürchtend, zum Hause hinaus und seiner Wohnung zu. Die Verbündeten zogen lachend ab.
Mynheer Slyker aber war wie durch ein Wunder nicht allein von seiner Leidenschaft für Elizabeth Leuwenbroek, sondern von der Zuneigung zu allen möglichen jungen Damen von Stund an auf’s Gründlichste geheilt, so zwar, daß er später wegen seiner Weiberfeindschaft förmlich berüchtigt wurde.
----
===Die heil. Magdalena nach der Geißelung. Von Marco Antonio Franceschini.===
[[File:Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden) Galeriewerk Payne 058.jpg|500px|center]]
Der Meeresküste entlang, etwa fünf Stunden entfernt von Genua, trieb ein junger Mensch an einem Spätnachmittage des Jahres 1672 sein schon ziemlich warm gerittenes Roß so eifrig zu raschem Trabe an, daß man schließen konnte, der Reisende setze in sein edles Thier das Zutrauen: dasselbe werde ihn noch heute zur Nachtherberge in Genua führen.
Das Roß so wenig als der Reiter waren aus dieser Gegend. Dieser schlanke, schwanenhalsige Schweißfuchs war unendlich von den unschönen Piemontesischen Gebirgskleppern verschieden und erinnerte in Gang und Haltung an die edlen Rosse, welche von englischen Pferdezüchtern damals in der Nähe von Bologna zu ziehen versucht wurden. Sattelzeug und Zügel waren mit Muscheln und Lederfranzen nach mittelitalienischem Geschmacke geziert.
Der Reiter war in der kleidsamen Tracht eines bologneser Studenten, im Sammtwamms mit großem, weißem Kragen und Stulphandschuhen und in langen, gelben Stiefeln, die bis auf den Oberschenkel reichten. Ein übermäßig langer Degen, schmal, aber zu Hieb und Stoß geeignet, mit einem kunstreich verschlungenen Handkorbe, fehlte dem jungen Manne ebenfalls nicht; statt des mächtigen Studentenhutes mit der wehenden Feder drauf trug er jedoch ein einfaches Sammtbaret, das als ganzen Schmuck an der Seite nur einen mit Edelsteinen gezierten, glänzenden Ring zeigte, dessen zierlicher Durchmesser leicht errathen ließ, daß eine schöne Damenhand das Kleinod getragen habe.
Das eigenthümliche Baret ließ den Malerschüler erkennen. Der Künstler sprach aus dem sanftblickenden Auge, aus der halb schwärmerischen Beschaulichkeit, womit der Reiter die herrlichen Tinten betrachtete, welcher die immer rascher sinkende Sonne über das Meer zu seiner Linken und über die Gebirgsgegend der Küste ausgoß. Von Zeit zu Zeit hielt der Reisende sein Roß einige Minuten an, entblößte eine Hand, zart wie diejenige einer Dame, und zeichnete rasch einige Hieroglyphen in sein Taschenbuch, um die wechselnden Lichteffecte und das Verschmelzen der Farben in dieser abendlichen Landschaft durch seinen einfarbigen Stift festzuhalten. Dann ging’s rasch wieder vorwärts auf der schlechten, fast durchaus menschenleeren, steinigen Straße.
Kurz vor Sonnenuntergang erblickte dieser bolognesische Reiter auf dem Schnitte eines sanft ansteigenden Theiles der Straße eine von einem berittenen Cavaliere begleitete mächtige Carosse, welche sich so langsam fortbewegte, daß er dieselbe bald einholte. Als er in die unmittelbare Nähe des Fuhrwerkes kam, hielt der Begleiter desselben sein durchaus abgetriebenes Pferd an, ritt mitten auf die Straße, machte gegen den Jüngling Front und zog, nachdem er die Halfterklappe von seinen Pistolen zurückgeschlagen, einen Degen, welcher eine Art von Zwillingsbruder von dem Bratenspieße des Malers zu sein schien.
Dieser hielt sehr betroffen sein Pferd an und zog seine Waffe fast ohne es zu wissen. Derjenige, welcher ihm hier so unerwartet den Weg verrannte, war ein Mann von etwa dreißig Jahren, in durchaus französischer, halb militairischer Tracht, mit dem Federhute eines Cavaliers versehen. Der Blick aus seinen dunkelglühenden Augen erweckte für diesen hohen und schlanken schnurrbärtigen Kämpfer unwillkürliche Achtung, zumal bei dem zierlich gebauten Maler, der augenblicklich einsah, er werde, wenn ihm nicht die Schnelligkeit seines Rosses zur Hülfe komme, diesem Schlagfertigen erliegen.
– <tt> Qui vive? </tt> rief der Cavalier. Wer seid Ihr und was wollt Ihr von mir?
– Signor! antwortete der Bolognese; ich müßte mich sehr täuschen, oder Ihr seid kein Straßenräuber, dem es um meine freilich nicht schwere Börse zu thun ist . . .
– Wie! Ein Bandit, mein Herr? rief der Andere erstaunt aus, erst den Maler und dann sich selbst und seinen in Unordnung gekommenen Anzug musternd. <tt>Morbleu! </tt> Wie dürft Ihr Euch unterfangen, einen Edelmann für einen Landstraßenräuber zu halten . . .
Der Maler stieß seinen Degen in die Scheide und ritt dreist an den Franzosen hinan.
– Mein Herr, ich sehe, meine Erscheinung macht Euch nicht weniger besorgt, als im ersten Momente die Einige Euren ergebensten Diener.
– Besorgt? sagte der Franzose, fast höhnend seine Lippen aufwerfend.
– Si, Signor! Es ist mir nicht beigekommen, Euch oder jene Kalesche zu verfolgen!
– Ah, mein theuerster Mann, wie kannst Du den Feind verfolgen, bevor du ihn geschlagen hast . . . murmelte der Franzose, aber es war ersichtlich, daß ihn diese friedlichen Auseinandersetzungen sehr erleichterten. Sein Blick war wenig düster, seine Miene weniger gepreßt. Er ließ seinen bisher erhobenen Degen sinken, fast unwillkürlich mit demselben vor dem Italiener salutirend.
– Ich denke auf meiner friedlichen Reise keine Feinde zu finden! sagte der Jüngling sich zum Gegengruße anmuthig verbeugend. Ich heiße Marco Antonio Franceschini, bin Maler, ein Schüler des berühmten Meisters Cignani in Bologna, und befinde mich nach einer ziemlich beschwerlichen Reise zum ersten Male in dieser Gegend, um zu versuchen, ob ich Cartons zu musivischen Arbeiten für den Rathssaal zu Genua zu liefern vermag . . .
Der Franzose zog seinen duftenden Lederhandschuh aus und reichte dem Künstler die Rechte.
– Ich begrüße Euch, Herr Maler, und versichere Euch meiner aufrichtigen Hochachtung. Ich bin der Chevalier La Touche, Colonel im ersten Regiment der Fußgarden des Königs von Frankreich, komme von Torino und werde versuchen, vom ersten besten Flecke dieser Küste aus nach irgend einem französischen Hafen zu reisen, und solltet Ihr mir bei diesem Versuche bis Genua Gesellschaft leisten und vorkommenden Falls Euren tapfern Arm zu Diensten stellen wollen, so werden Euch zwei edle Herzen für Euren Freundschaftsdienst auf immer Dank wissen.
Antonio Franceschini war nichts weniger als feig und zaghaft, und sein Degen wußte schon von mehr als einem blutigen Rencontre zu erzählen.
– Ich bin der Eurige! sagte er daher und ritt dich neben La Touche, der sein ermüdetes Pferd in einem faulen Trabe zu erhalten sich bemühte.
Die Kutsche ward, ungeachtet sie mit vier starken Mauleseln bespannt war, bald eingeholt. Ein blendend weißer Arm schlug die grünen Vorhänge inwendig von den Fenstern zurück und ein hinreißend schönes Frauenantlitz schaute mit einem angstvollen Blicke auf die beiden zur Seite des Schlages trabenden Männer.
La Touche streckte, dem Maler einen vielsagenden Blick zuwerfend, die Hand grüßend nach der reizenden Dame aus. Er schien fragen zu wollen:
– Ist hier selbst für einen Fremden nicht genug Ursache, um zu fechten und nötigenfalls zu sterben?
Franceschini war fast erschrocken über den hohen Stand der augenscheinlich flüchtigen Dame, auf welchen ihre beiden reich gekleideten Dienerinnen und ein in der Hinterchaise ziemlich angstvoll sitzender rabenschwarzer Negerknabe schließen ließen.
La Touche sah den Künstler bedeutungsvoll an; dann sagte er nach längerem Schweigen:
– Eine Frage schwebt auf Euren Lippen: wer ist diese Dame? Ich sage Euch, Freund, sie ist heute nichts als ein liebendes Mädchen, als die Geliebte desjenigen, der neben Euch reitet. Und zur Rettung eines Liebespaares möchtet Ihr, ein Künstler, der Herzensempfindungen versteht, noch wohl besser beitragen können, als dadurch, daß Ihr uns einfach Gesellschaft leistet. Wollt Ihr für jene Kutsche sammt den vermaledeiten, lahmgewordenen Maulthieren, so wie sie da sind, Euer feuriges, kräftiges Pferd mir abtreten? Uns ist ein Pferd wahrhaft mehr als ein Königreich, es ist unser Leben werth . . . . . Meine Dame fürchtet den Sattel nicht, und sind wir Beide beritten, so können wir unbemerkt fortkommen, statt jetzt gleich dem Großmogul zu reisen.
Franceschini war leicht exaltirt. Er stieg sofort vom Pferde und schwor, er werde für die Dame nicht allein bis nach Genua, sondern bis an’s Ende der Welt zu Fuß gehen. Die Dame stieg aus und La Touche bemühte sich, den Maler zu überreden, in der Kutsche Platz zu nehmen.
Mitten in dieser Unterredung stieß La Touche einen furchtbaren Soldatenfluch aus und rief:
– Flieh, Maddalena! Wirf Dich auf diesen Fuchs; wir werden mit diesen Canaillen fertig werden oder dabei umkommen . . .
Maddalena aber floh nicht; sie suchte vielmehr den Geliebten mit ihrem zarten Körper zu decken. Die Verfolger, diesmal die wahren Verfolger, kamen heran, drei Männer auf vortrefflichen Pferden; voran ein bejahrter Herr in fürstlicher Kleidung und mit Brillant-Schnallen am Hute.
– Kamerad! rief La Touche, indeß er sich hinter sein Roß stellte und Maddalena fester in seinen linken Arm schloß; Kamerad, der Franzose hat hier keinen Pardon zu erwarten . . . Gereut Dich Dein Weit, so tritt zur Seite . . . Hier wird Nichts geschont . . .
La Touche feuerte trotz des Kreischens der Dame und der vorderste, alte Cavalier sank taumelnd zur Erde.
– Mein Vater! seufzte die Italienerin und schwankte ohnmächtig auf den Gefallenen zu.
– Hunde! rief ein kraftvoller Mann, sein Pistol auf Franceschini abbrennend und dann mit hochgeschwungenem Degen auf ihn, der ihm am nächsten stand, eindringend. Mörder des Prinzen von Carignan, Ihr werdet Eurem Geschicke nicht entgehen!
Franceschini sparte seine Pistolenschüsse, parirte den Hieb und dankte dafür mit einer ächten bologneser Innerquart, die dem Reiter durch Rippen und Rücken fuhr. Während dieses Engagements war La Touche, jetzt zunächst von Kampfeslust hingerissen, vorwärts gesprungen, um den Dritten zu entwaffnen. Kühn faßte er den Ziegel des Pferdes und rief:
– Florina, Du warst nie mein Freund, ergieb Dich und wir werden sehen, wie unsere Sachen stehen . . .
Florina aber, kaum zwanzig Jahre, ergab sich nicht, antwortete auch nicht, als durch einen Pistolenschuß. La Touche ließ die Arme sinken, stand aber unerschüttert; dann faßte er seinen Feind und warf ihn vom Pferde.
– Ich bin ein verlorner Mann! schrie er mit lauter Stimme. Aber Du, Freund, stirbst wenigstens mit mir.
Der Stiletstoß, welcher den Piemontesen stumm machte, war La Touche’s letzte Kraft. Er streckte sich als Sieger über seinen Feind aus, in demselben Augenblicke: Maddalena! murmelnd, als diese selbst sich über ihn warf, als könnte sie durch die Gewalt ihrer Liebe sein fliehendes Leben aufhalten.
In kaum einer Minute hatte der Tod eine reiche Ernte gehalten, obgleich Amadeus, Prinz von Carignan, nicht gestorben war. Er nahm die Hülfeleistung Franceschini’s dankbar an, wies aber seine Tochter Maddalena finster von sich.
– Lebt dieser fränkische Abenteurer? fragte er, nachdem er sich mit Mühe erhoben hatte und mit Franceschini’s Hülfe auf die Kutsche zu schwankte, mit matter Stimme.
– Todt! erwiderte der Maler eintönig.
– Die Heiligen seien gepriesen! Das wenigstens ist ein Atom der Rache, die centnerschwer meine Brust bedrückt. Und Du? Ungehorsame, maßlos Elende, verblendetes Geschöpf ohne Gefühl und Ehre, Du? Ich kenne Dich nicht . . . Ich weiß nicht, ob ich in nächster Minute sterben werde, aber den schwersten Fluch, den ich Dir auferlege, kann ich auch in dieser Minute vor Gottes Richterstuhle verantworten.
Franceschini ließ den Kutscher bei den Todten zurück, ließ die beiden Dienerinnen zu Fuße gehen und hob die ohnmächtige Maddalena auf den Kutschersitz, indeß er selbst eines der Maulthiere bestieg. So fuhr er langsam bis Mitternacht, wo er, an einer einsamen Herberge anderthalb Stunden von Genua angekommen, den Prinzen von Carignan abladen und auf ein sorgfältig bereitetes Lager betten konnte.
Der Prinz war edel genug, den Maler als seinen treuen Diener zu bezeichnen und ihm den Auftrag zu geben, von der Stadt einen Arzt herbeizuholen. Maddalena, fast geistesabwesend, ward in einem festen Kämmerlein verschlossen.
Kaum aber war Franceschini zehn Minuten unterweges, da hörte er lautes Rufen hinter sich. Maddalena mit ihrer Lieblingsdienerin und dem afrikanischen Knaben eilten trotz des schlechten Weges nach und standen jetzt athemlos neben seinem Pferde.
– Um der ewigen Barmherzigkeit willen, sagte die Prinzessin, rettet mich! Rettet mich vor meinem Vater, noch mehr, rettet mich vor mir selbst. Geleitet mich nach Genua, geleitet mich zum Kloster Unserer lieben Frau der Hülfe, damit ich ruhig sterben kann.
Franceschini gehorchte; er fand einen Arzt auf und brachte seine Schützlinge zum Kloster. Hier erst konnte er sich mit sich selbst beschäftigen. Jene Pistolenkugel hatte zwar nur sehr sanft gefaßt, dennoch war seine Streifwunde an der Brust nicht gering. Als die Klosterfrauen den vornehmen Flüchtling voll Mitleid empfangen hatten, war es ihm dunkel vor den Augen und er sank in demselben Augenblicke bewußtlos vor Maddalena auf das Pflaster des Klosterhofes, als er von ihr ewigen Abschied nehmen wollte.
Als der Maler wieder erwachte, fand er sich auf den harten Lager einer kleinen Nonnenzelle ausgestreckt und zwei fromme Schwestern saßen neben ihm. Er besann sich rasch, was geschehen war, und sein Entschluß war bald gefaßt. Es däuchte dem Künstler hier in Genua nicht geheuer . . . . . Ihn kannte Niemand . . . . . Niemand noch hatte ihn außer den Nonnen gesehen . . . Es galt schleunigste Entfernung von diesem gefährlichen Boden.
Bevor er aber ging, wollte er die unglückliche, durch verbotene Liebe unglücklich gewordene Prinzessin von Carignan noch einmal sehen. Seine Bitten bei der Aebtissin drangen endlich durch, man öffnete ihm die Zelle der neuen Magdalena. Ohnmächtig werdend befand sich Maddalena in den Armen ihrer Dienerin, indeß eine Novizin und eine Klosterschwester sich um sie bemühten, um ihr Muth einzusprechen und sie auf ihr Lager zu bringen. Zu Boden geschleudert war ihr reicher Schmuck, den der kleine Neger kaum aufzuheben wagte. Maddalena selbst war halb entkleidet und ihre ermattende Hand hielt noch die Geißel, mit welcher sie die grausamen Bußzüchtigungen an sich vollzogen hatte, welchen ihr zarter Körper, ohnehin von Seelenqual verzehrt, in kaum fünf Monaten unterlag . . .
Franceschini ging zur See von Genua ab und kam wieder auf das sichere Gebiet der Santa Chiesa. Das Bild der Maddalena aber verließ ihn nie mehr, und begeistert von jenem Angedenken schuf er eins seiner ausgezeichnetsten Oelgemälde, das die glänzenden Vorzüge Cignani’s und Guido Reni’s in sich zu vereinigen scheint.⏎
⏎
⏎
{{References|LIN}}
[[Kategorie:Kunstwissenschaft]]
This site is not affiliated with or endorsed in any way by the Wikimedia Foundation or any of its affiliates. In fact, we fucking despise them.
|